
- 2025
- The Stories We Inhabit, Kunstraum Ideal Leipzig /E
Nach Anna Lülja Praun, S.I.X., Seewalchen / G
Hinschaun! / Poglejmo!, Kärnten Museum, Klagenfurt /G
Das menschliche und das tierische Wesen, Ursulinenkirche, Linz /E
Suburbia, Architekturzentrum Wien /D
Kardinal König Kunstpreis, Bildraum, Bregenz /G - 2024
- Ich muss mich erstmals sammeln!, HLMD - Hessisches
Landesmuseum Darmstadt /G
Kardinal König Kunstpreis, Lentos, Linz /G
Preise und Talente 2023, Kunstsammlung Oberösterreich, Linz /G
Kulturpreise des Landes Niederösterreich 2024, DOK NÖ Niederösterreichisches Dokumentationszentrum, St.Pölten /G
Neues aus der Sammlung, Kunstsammlung Oberösterreich, Linz /G
Steirische Fotobiennale, Altes Kino Leibnitz /G
Landschaft re_artikulieren, Museum Moderner Kunst Klagenfurt (cat.) /G
Schriftmuseum Pettenbach, Pettenbach /D
Über die Schwelle, Kunst und Kultur der Diözese Linz,
Hallstatt - Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut /G
NHM Biennale Klimatalk#1, Naturhistorisches Museum Wien,
Klima Biennale Vienna /V
Art&Function_Performance, Kunsthaus Mürz, Mürzzuschlag /G
Die Reise der Bilder, Lentos Linz – Kulturhauptstadt Bad Ischl
Salzkammergut (cat.) /G
Broncia Koller-Pinell, Belvedere, Vienna (cat.) /D
Gedenkort Reichenau Innsbruck, Kunst im öffentlichen Raum
(competition) /P
Täterätätää, Back with a Bang!, Kunsthalle Exnergasse, Vienna /G
Sudhaus. Kunst mit Salz und Wasser, Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut /G - 2023
- Observations, Collecting Norden, Worlding Northern Art (WONA) and Exploration, Exploitation and Exposition of the Gendered Heritage of the Arctic (XARC), Acadamy of Arts, Tromsø /V
Kyiv Biennale 2023, Vienna /G
Coincidence of Wants, Musa Wien Museum /G
graben/Landschaft/lesen-kopati/Grapo/brati,Bad Eisenkappel/Železna Kapla/G
Wer gedenkt der Partisaninnen und Partisanen? – Kdo se spominja partizank in partizanov?, Museum am Peršmanhof/Muzej Peršmanu, Železna Kapla /G
Labor und Bürogebäude an der Johannes Gutenberg Universität Mainz, Kunst im öffentlichen Raum (Wettbewerb) /P
Display und Ausstellungsraum, BIG ART, BIG, Vienna /D
LBS Holztechnikum Kuchl, Kunst im öffentlichen Raum (competition) /P
Künstler*innenbücher zu Gast: Nicole Six und Paul Petritsch,
Fotohof, Salzburg /E
Shared Space, Versuchsanstalt WUK Kunsthalle Exnergasse, Vienna /E
Edition Camera Austria (Hrsg. Reinhard Braun), Graz /D
@domplatz, Koroška/Kärnten gemeinsam Erinnern / skupno ohranimo spomin, Initiative Domplatz, Universität Klagenfurt /G - 2022
- Das Fest, MAK – Museum of Applied Arts, Vienna /G
Nach 2022 Jahren, Schlossmuseum, Linz /E
Koroška/Kärnten gemeinsam Erinnern / skupno ohranimo spomin, Initiative Domplatz, Kunst im öffentlichen Raum /P
Der Park, St.Agnes, Völkermarkt /G
Lueger Temporär, KÖR, Vienna /E
Inner Boarder, Pavelhaus | Pavlova Hiša, Radkersburg /G
Herbert Bayer, Lentos, Linz /D
Tableaux Vivants/Moving Stills, Architekturforum Zürich /G
Monumental Cares, University of Applied Arts, Vienna /V
XX Y X, Echoraum, Vienna /G
Rethinking Nature, Foto Wien /G - 2021
- Hungry for Time, Academy of Fine Arts Vienna /G
Retrospective Österreichischer Grafikwettbewerb, Taxispalais
Kunsthalle Tirol, Innsbruck /G
Notations, reflections & strategies of display, Contingent Agencies, Vienna /G
Later, gfk-Gesellschaft für Kulturpolitik OÖ, Linz /G
Rethinking Nature, Imago Lisboa, Lisboa /G
Tagung Block Beuys, Hessisches Landesmuseum Darmstadt (cat.) /D
Rethinking Nature, Casino Luxembourg - Forum d'art, Luxembourg /G
A Short History of Camera Traps, Fotograf Gallery, Prague /G
Gemeindezentrum Vöcklamarkt, Art in public space (competition) /P
Forming the Reformed, Academy of Fine Arts, Prague /V - 2020
- Der Angriff der Gegenwart, Universitätsgalerie Heiligenkreuzer Hof, Vienna (cat.) /G
Kärnten Koroška, von A-Ž, Landesgalerie Klagenfurt (cat.) /G
Nach uns die Sintflut, Kunst Haus Vienna (cat.) /G
Die Stadt & Das gute Leben, Camera Austria, Graz /G
Unplugged, Rudolfinum, Prague (cat.) /G
Carinthija, 2020, State Exhibition, Carinthia /G
Sexy Pages, Atelierhaus Hannover /G
Feuerstelle, lower austrian culture, art in public space , Klein-Meiseldorf /P
Fastentuch Vöcklamarkt, Diözesankonservatorat Linz /P
Die Nachbarn, Art in public space, Salzburg (competition) /P
Editionale Wien, University of Applied Arts, Vienna /G
The World to Come, DePaul Art Museum, Chicago (cat.) /G - 2019
- Ozeanische Gefühle, Hessisches Landesmuseum Darmstadt /E
Im Raum die Zeit lesen, mumok - Museum moderner Kunst
Stiftung Ludwig, Vienna /G
Vienna Art Book Fair #1, VABF with University of Applied Arts Vienna /G
Tag des Denkmals - Sea of Tranquility, The Pit, Breitenbrunn /V
Cinema of the Anthropocene, UNC-Wilmington, North Carolina /V
50 Jahre Mondlandung-10 Jahre Salzamt, Salzamt, Linz /G
ticket to the moon, Kunsthalle Krems (cat.) /G
Für die Vögel, lower austrian culture, art in public space /P
The World to Come, UMMA University Michigan Museum of Art (cat.) /G
Lentos-Außen, Linz (competition) /P
Klagenfurter Kunstfilmtage, Klagenfurt /V
Österreichbild, Architekturzentrum Vienna /P
Lassnig-Rainer, Lentos, Linz (cat.) /D - 2018
- Aufbruch ins Ungewisse – Österreich seit 1918,
Haus der Geschichte, Vienna /G
Lost and Found, T.R.A.M., Vienna/Bratislava (cat.) /P
In the case, haaaauch-quer, Klagenfurt /P
Das Denkmal, Museum und Gedenkstätte Peršmanhof, Železna Kapla /V
Rennes Ours, colophon, achevé d'imprimer : le livre d'artiste et le péritexte, Cabinet du Livre d'artiste, Agen, France /G
Project for the preservation of a tumulus, Großmugl, Lower Austria /P
Sommerfrische Reloaded 2018, S.I.X., Seewalchen /G
The World to Come, Harn Museum of Art, Florida (cat.) /G
Yesterday Today Today, Kunstraum Buchberg, Schloss Buchberg (cat.) /G
Garten der Künstler, Minoritenkloster, Tulln (cat.) /G
Post Otto Wagner, MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst, Vienna (cat.) /G
Das andere Land, Museum Moderner Kunst Klagenfurt (cat.) /G
1918- Klimt. Moser. Schiele. Gesammelte Schönheiten, Lentos, Linz /D
Auf die Plätze / Na mesta, Künstlerhaus Klagenfurt /G - 2017
- Floor, Wall, Body, Offspace-Night Vienna Art Week, Vienna /V
Grau in Grau – Ästhetisch Politische Praktiken der Erinnerungskultur,
Kunstuniversität Linz /V
Flüchtige Territorien, Kunstraum Niederösterreich, Vienna (cat.) /G
Uncommon Places, Goethe Institut, Hongkong /G
Mapping Terrains, Arccart, Vienna /G
Stretching the Boundaries, Fluca, Plovdiv /G
Kunst am Bau, Bruckner-Universität, Linz (competition) /P
Sterne. Kosmische Kunst, Lentos, Linz (cat.) /G
Un-Curating the Archive, Camera Austria, Graz /E
Unschärfen und weiße Flecken, Künsthaus Mürz (cat.) /G
AHEAD of the Game!, Künstlerhaus Klagenfurt /G - 2016
- Einrichtung, Camera Austria, Graz /D
Psst: there is still place in outer space!, Pavelhaus/Pavlova Hiša,
Radkersburg /G
Am Ende: Architektur, Architekturzentrum Vienna /D
Mahnmal für aktive Gewaltfreiheit, Linz (competition) /P
Herwig Turk Landschaft=Labor, Museum Moderner Kunst
Klagenfurt (cat.) /G
Ein stiller Begleiter, Großmugl /P
Seeing is believing, Museum Angerlehner, Wels (cat.) /G
SUPER J’arrive, Super Wien, Vienna /G - 2015
- Das Denkmal, Institut für Staatswissenschaften, Vienna /V
Filmbau. Schweizer Architektur im bewegten Bild, SAM Schweizerisches
Architekturmuseum, Basel (cat.) /G
Mehr als Zero, Hans Bischoffshausen, Österreichische Galerie Belvedere,
Vienna (cat.) /D
Fronteras En Cuestión II, Centro de Desarollo de las Artes Visuales,
Habana /G
Revers de Tromp, Academy of fine arts Vienna /G
Das Denkmal, Parallel Vienna, Vienna /G
Palm Capsule, Exposition Park, Los Angeles /P
Uncommon Places, Synthesis Gallery of Photography, Sofia /G
Fictitious Tales about the History of Earth, MAK Center, Los Angeles /G
Nicole Six & Paul Petritsch, Das Denkmal, Kunstraum Lakeside,
Klagenfurt /E
Mainzer Ansichten, Kunsthalle Mainz /E
The Visual Paradigm, Camera Austria, Graz /G
Vienna for Art`s Sake, Winter-Palast Belvedere, Vienna (cat.) /G - 2014
- Lichtblicke, Universitätskulturzentrum UNIKUM und section a, Trzic /G
Korrelation, Angewandte Innovation Laboratory, Vienna /G
Wirklichkeit und Konstruktion, Stadtgalerie Klagenfurt (cat.) /G
Die Gegenwart der Moderne, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig /V
Unframed, Galerie Raum mit Licht und Eikon, Vienna /G
Archives, Re-Assemblances and Surveys, On Austrian Contemporary
Photography, Klovicevi dvori Gallery, Zagreb (cat.) /G
Nicole Six und Paul Petritsch, Das Meer der Stille, Landesgalerie Linz (cat.) /E
Fade into You, Kunsthalle Mainz /V
MAK Design Labor, MAK – Österreichisches Museum für angewandte
Kunst, Vienna /G
Places of Transition, Freiraum – MuseumsQuartier Wien (cat.) /D - 2013
- Suicide Narcissus, The Renaissance Society, Chicago /G
Gefährdung, Entzug und grundloses Aushalten, Transmediale Kunst -
Universität für angewandte Kunst, Vienna /V
Vienna for Art`s Sake, Benetton Collection, Treviso (cat.) /G
Kunstgastgeber – Rennbahnweg 27, KÖR Kunst im öffentlichen Raum,
Vienna (Kat.) /P
Denkmal für die Verfolgten der NS-Miltärjustiz, Ballhausplatz 1010 Vienna /P
Nebelland hab ich gesehen, Museum Moderner Kunst Klagenfurt (cat.) /G
Is it really you, Kunstsammlung Oberösterreich, Linz /G
Praxis der Liebe, Salzburger Kunstverein, Salzburg /D
Das Bauhaus in Kalkutta, Bauhaus Dessau /D
Wolken, Welt des Flüchtigen, Leopold Museum, Vienna (cat.) /G
Schuss / Gegenschuss, in: Camera Austria, Nr. 121 /P - 2012
- Art is Concrete, Camera Austria, Graz /D
Sowjetmoderne, Architekturzentrum Vienna /D
Aus, Schluss Basta oder Wir sind total am Ende, Schauspielhaus Graz /V
Keine Zeit, erschöpftes Selbst / entgrenzetes Können, 21er Haus,
Vienna (cat.) /G
Space Affairs, Musa, Vienna /G
Aussicht kann durch Ladung verstellt sein, Kunstverein Medienturm,
Graz (cat.) /E - 2011
- Im täglichen Wahnsinn den Zauber finden!, Kunstraum Goethestrasse
xtd, Linz /G
Schall und Rauch, die Vertikale und der freie Fall, TransArts - Universität
für angewandte Kunst, Vienna /V
If a tree falls in the forest, and nobody hears it, does it make a sound?,
Galerie Lisa Ruyter, Vienna /G
Das Ding an sich, Mariendom, Linz /P
Raum für 17 Minuten 6’23’’, Galerie im Taxispalais, Innsbruck (cat.) /E
Prima Interventionen, Atelierhaus Salzamt, Linz /G
Proposals for Venice, Landesgalerie Linz (cat.) /G - 2010
- Körper Codes, Museum der Moderne Salzburg /G
Der Aufstand der Zeichen, k48, Vienna, Intervention im öffentlichen Raum /P
Heimat/Domovina, Museum Moderner Kunst Klagenfurt (cat.) /G
Triennale Linz 1.0, Linz (cat.) /G
Blind Date, Kunstverein Hannover /E
Atlas, Secession, Vienna (cat.) /E
Upon Arrival, Malta Contemporary Art, Malta (cat.) /G - 2009
- Österreichischer Grafikwettbewerb (31), Galerie im Taxispalais,
Innsbruck (cat.) /G
Mahnmal für die Zwangsarbeitslager St. Pölten - Viehofen,
in Zusammenarbeit mit Jeanette Pacher (nicht realisiert) /P
Das menschliche und das tierische Wesen, Ursulinenkirche, Linz /E
Reading the City, ev+a 2009, Limerick (cat.) /G
Spotlight, Museum der Moderne, Salzburg /G - 2008
- Undiszipliniert, Das Phänomen Raum in Kunst, Architektur und Design, Kunsthalle Exnergasse, Vienna (cat.) /G
Peter Zumthor, Bauten und Projekte 1986–2007 mit einer Filminstallation von Nicole Six & Paul Petritsch, Experimentadesign, Lissabon /P
zu Gironcoli, Gironcoli Museum, Herberstein /G
K08, Emanzipation und Konfrontation, Künstlerhaus Klagenfurt (cat.) /G
Was ist ein Platz? Was ist ein Cy-BORG-Platz?, Temporäre Kunst im Stadtraum, Wiener Neustadt /P
unterwegs sein, Kunstraum Düsseldorf (cat.) /G
Bildpolitiken, Salzburger Kunstverein, Salzburg /D
Kontakt...aus der Sammlung der Erste Bank-Gruppe, Institut
of Contemporary Art, Dunaújváros /D
zoom and scale, Akademie der bildenden Künste, Vienna /G - 2007
- Max Ernst und die Welt im Buch, Museum der Moderne, Salzburg /G
Peter Zumthor, Bauten und Projekte 1986–2007 mit einer Filminstallation von Nicole Six & Paul Petritsch, KUB Kunsthaus Bregenz /P
Temporally, The Israeli Center for Digital Art, Holon /G
Margherita Spiluttini. Atlas Austria, Architekturzentrum Vienna /D
Kunstverein Baden, Kunstverein Baden /G
Blickwechsel Nr.3, MMKK, Klagenfurt (cat.) /G
I`m too tired to tell you, Agentur, Amsterdam /E
Film ab, Universität für Musik und darstellende Kunst, BIG, Vienna /P
Kontakt Belgrad...aus der Sammlung der Erste Bank-Gruppe, Museum Moderner Kunst, Belgrad /D - 2006
- Longitude / Latitude, haaaauch, Klagenfurt /E
Nicole Six / Paul Petritsch, Gesellschaft für aktuelle Kunst, Bremen /E
First the artist defines meaning, Camera Austria, Graz /G
Société des nations, Circuit, Lausanne /G
How and Wow, Experimentelle Gestaltung Kunstuniversität Linz, Linz /V
Kontakt...aus der Sammlung der Erste Bank-Gruppe, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Vienna /D
Margherita Spiluttini. Atlas Austria, Architekturzentrum Wien mit Arco, Madrid /D - 2005
- Tu Felix Austria…Wild at Heart, KUB Kunsthaus Bregenz (cat.) /G
Home Stories, Architekturzentrum Wien mit Austrian Cultural Forum,
New York /D
Das Spannende ist doch die Organisation von Materie, Area 53, Vienna /G
Wisdom of Nature, Nagoya City Art Museum, Nagoya (cat.) /G
Das Neue 2, Atelier im Augarten, Zentrum für zeitgenössische Kunst der Österreichischen Galerie Belvedere, Vienna (cat.) /G
Großmugl, Wettbewerb Kunst im öffentlichen Raum, Großmugl
(unrealized) /P
Museums-Empfangsbereich, Frac Lorraine, Metz, Frankreich /P
Slices of Life, blueprints of the self in painting, Austrian Cultural Forum,
New York /D - 2004
- Open Studio, ISCP, New York /G
Transgressing-Systems, Ausstellen zu Bauen und Kunst, Innsbruck /G
1.33.33, Area 53, Wien /G
Permanent Produktiv, Kunsthalle Exnergasse, Vienna /G
White Spirit in Public Spaces, F.R.A.C. de Lorrain, Metz /G
The Austrian Phenomenon / Konzepte Experimente Wien Graz 1958-1973, Architekturzentrum Vienna /D - 2003
- Fata Morgana, Wettbewerb Silos Graz-West, Kulturhauptstadt Graz 2003
in collaboration with Jeanette Pacher (unrealized) /P
Flutlichtmast, Wettbewerb Kunst im öffentlichen Raum in Rohrendorf
in collaboration with Hans Schabus (unrealized) /P
Trauer, Atelier im Augarten, Zentrum für zeitgenössische Kunst der Österreichischen Galerie Belvedere, Vienna (cat.) /G
America, bgf_plattform, Berlin /G
Extended Architecture, Tanzwerkstatt Europa, Neues Theater, München /G
just build it! Die Bauten des Rural Studio, Architekturzentrum Vienna /D
site-seeing: disneyfizierung der städte, Künstlerhaus Vienna /D - 2002
- artists´choice, CAT Contemporary Art Tower – MAK
Gegenwartskunstdepot, Vienna /E
space off, supersaat, Vienna /G - 2001
- moving out, Universität für angewandte Kunst, Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Vienna /D
/E Solo Exhibition
/G Group Exhibition
/P Projects: Interventions, Public Space, Competition or realized Projects
/D Display: Exhibition, Catalogs
/V Lecture and Screenings, Presentations
- 2025
- The Stories We Inhabit, Kunstraum Ideal Leipzig /E
Nach Anna Lülja Praun, S.I.X., Seewalchen / G
Hinschaun! / Poglejmo!, Kärnten Museum, Klagenfurt /G
Das menschliche und das tierische Wesen, Ursulinenkirche, Linz /E
Suburbia, Architekturzentrum Wien /D
Kardinal König Kunstpreis, Bildraum, Bregenz /G - 2024
- Ich muss mich erstmals sammeln!, HLMD - Hessisches
Landesmuseum Darmstadt /G
Kardinal König Kunstpreis, Lentos, Linz /G
Preise und Talente 2023, Kunstsammlung Oberösterreich, Linz /G
Kulturpreise des Landes Niederösterreich 2024, DOK NÖ Niederösterreichisches Dokumentationszentrum, St.Pölten /G
Neues aus der Sammlung, Kunstsammlung Oberösterreich, Linz /G
Steirische Fotobiennale, Altes Kino Leibnitz /G
Landschaft re_artikulieren, Museum Moderner Kunst Klagenfurt (Katalog) /G
Schriftmuseum Pettenbach, Pettenbach /D
Über die Schwelle, Kunst und Kultur der Diözese Linz,
Hallstatt - Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut /G
NHM Biennale Klimatalk#1, Naturhistorisches Museum Wien,
Klima Biennale Wien /V
Art&Function_Performance, Kunsthaus Mürz, Mürzzuschlag /G
Die Reise der Bilder, Lentos – Kulturhauptstadt Bad Ischl
Salzkammergut (Katalog) /G
Broncia Koller-Pinell, Belvedere, Wien (Katalog) /D
Gedenkort Reichenau Innsbruck, Kunst im öffentlichen Raum
(Wettbewerb) /P
Täterätätää, Back with a Bang!, Kunsthalle Exnergasse, Wien /G
Sudhaus. Kunst mit Salz und Wasser, Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut /G - 2023
- Observations, Collecting Norden, Worlding Northern Art (WONA) and Exploration, Exploitation and Exposition of the Gendered Heritage of the Arctic (XARC), Acadamy of Arts, Tromsø /V
Kyiv Biennale 2023, Wien /G
Coincidence of Wants, Musa Wien Museum /G
graben/Landschaft/lesen-kopati/Grapo/brati,Bad Eisenkappel/Železna Kapla/G
Wer gedenkt der Partisaninnen und Partisanen? – Kdo se spominja partizank in partizanov?, Museum am Peršmanhof/Muzej Peršmanu, Železna Kapla /G
Labor und Bürogebäude an der Johannes Gutenberg Universität Mainz, Kunst im öffentlichen Raum (Wettbewerb) /P
Display und Ausstellungsraum, BIG ART, BIG, Wien /D
LBS Holztechnikum Kuchl, Kunst im öffentlichen Raum (Wettbewerb) /P
Künstler*innenbücher zu Gast: Nicole Six und Paul Petritsch,
Fotohof, Salzburg /E
Shared Space, Versuchsanstalt WUK Kunsthalle Exnergasse, Wien /E
Edition Camera Austria (Hrsg. Reinhard Braun), Graz /D
@domplatz, Koroška/Kärnten gemeinsam Erinnern / skupno ohranimo spomin, Initiative Domplatz, Universität Klagenfurt /G - 2022
- Das Fest, MAK – Museum für Angewandte Kunst, Wien /G
Nach 2022 Jahren, Schlossmuseum, Linz /E
Koroška/Kärnten gemeinsam Erinnern / skupno ohranimo spomin, Initiative Domplatz, Kunst im öffentlichen Raum /P
Der Park, St.Agnes, Völkermarkt /G
Lueger Temporär, KÖR, Wien /E
Inner Boarder, Pavelhaus | Pavlova Hiša, Radkersburg /G
Herbert Bayer, Lentos, Linz /D
Tableaux Vivants/Moving Stills, Architekturforum Zürich /G
Monumental Cares, Universität für angewandte Kunst, Wien /V
XX Y X, Echoraum, Wien /G
Rethinking Nature, Foto Wien /G - 2021
- Hungry for Time, Akademie der bildenden Künste Wien /G
Retrospective Österreichischer Grafikwettbewerb, Taxispalais
Kunsthalle Tirol, Innsbruck /G
Notations, reflections & strategies of display, Contingent Agencies, Wien /G
Later, gfk-Gesellschaft für Kulturpolitik OÖ, Linz /G
Rethinking Nature, Imago Lisboa, Lissabon /G
Tagung Block Beuys, Hessisches Landesmuseum Darmstadt (Kat.) /D
Rethinking Nature, Casino Luxembourg - Forum d'art, Luxembourg /G
A Short History of Camera Traps, Fotograf Gallery, Prag /G
Gemeindezentrum Vöcklamarkt, Kunst im öffentlichen Raum
(Wettbewerb) /P
Forming the Reformed, Akademie der Bildenden Künste Prag /V - 2020
- Der Angriff der Gegenwart, Universitätsgalerie Heiligenkreuzer Hof, Wien (Kat.) /G
Kärnten Koroška, von A-Ž, Landesgalerie Klagenfurt (Kat.) /G
Nach uns die Sintflut, Kunst Haus Wien (Kat.) /G
Die Stadt & Das gute Leben, Camera Austria, Graz /G
Unplugged, Rudolfinum, Prag (Kat.) /G
Carinthija, 2020, Landesausstellung, Kärnten /G
Sexy Pages, Atelierhaus Hannover /G
Feuerstelle, Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich, Klein-Meiseldorf /P
Fastentuch Vöcklamarkt, Diözesankonservatorat Linz /P
Die Nachbarn, Kunst im öffentlichen Raum Salzburg (Wettbewerb) /P
Editionale Wien, Universität für angewandte Kunst, Wien /G
The World to Come, DePaul Art Museum, Chicago (Kat.) /G - 2019
- Ozeanische Gefühle, Hessisches Landesmuseum Darmstadt /E
Im Raum die Zeit lesen, Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wien /G
Vienna Art Book Fair #1, VABF+Universität für angewandte Kunst Wien /G
Tag des Denkmals - Sea of Tranquility, The Pit, Breitenbrunn /V
Cinema of the Anthropocene, UNC-Wilmington, North Carolina /V
50 Jahre Mondlandung-10 Jahre Salzamt, Salzamt, Linz /G
ticket to the moon, Kunsthalle Krems (Kat.) /G
Für die Vögel, Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich /P
The World to Come, UMMA University Michigan Museum of Art (Kat.) /G
Lentos-Außen, Linz (Wettbewerb) /P
Klagenfurter Kunstfilmtage, Klagenfurt /V
Österreichbild, Architekturzentrum Wien /P
Lassnig-Rainer, Lentos, Linz (Kat.) /D - 2018
- Aufbruch ins Ungewisse – Österreich seit 1918,
Haus der Geschichte, Wien /G
Lost and Found, T.R.A.M., Wien/Bratislava (Kat.) /P
In the case, haaaauch-quer, Klagenfurt /P
Das Denkmal, Museum und Gedenkstätte Peršmanhof, Železna Kapla /V
Rennes Ours, colophon, achevé d'imprimer : le livre d'artiste et le péritexte, Cabinet du Livre d'artiste, Agen, Frankreich /G
Projekt zum Schutz eines Hügelgrabs, Großmugl, Niederösterreich /P
Sommerfrische Reloaded 2018, S.I.X., Seewalchen /G
The World to Come, Harn Museum of Art, Florida (Kat.) /G
Yesterday Today Today, Kunstraum Buchberg, Schloss Buchberg (Kat.) /G
Garten der Künstler, Minoritenkloster, Tulln (Kat.) /G
Post Otto Wagner, MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst, Wien (Kat.) /G
Das andere Land, Museum Moderner Kunst Klagenfurt (Kat.) /G
1918- Klimt. Moser. Schiele. Gesammelte Schönheiten, Lentos, Linz /D
Auf die Plätze / Na mesta, Künstlerhaus Klagenfurt /G - 2017
- Floor, Wall, Body, Offspace-Night Vienna Art Week, Wien /V
Grau in Grau – Ästhetisch Politische Praktiken der Erinnerungskultur,
Kunstuniversität Linz /V
Flüchtige Territorien, Kunstraum Niederösterreich, Wien (Kat.) /G
Uncommon Places, Goethe Institut, Hongkong /G
Mapping Terrains, Arccart, Wien /G
Stretching the Boundaries, Fluca, Plovdiv /G
Kunst am Bau, Bruckner-Universität, Linz (Wettbewerb) /P
Sterne. Kosmische Kunst, Lentos, Linz (Kat.) /G
Un-Curating the Archive, Camera Austria, Graz /E
Unschärfen und weiße Flecken, Künsthaus Mürz (Kat.) /G
AHEAD of the Game!, Künstlerhaus Klagenfurt /G - 2016
- Einrichtung,, Camera Austria, Graz /D
Psst: there is still place in outer space!, Pavelhaus/Pavlova Hiša,
Radkersburg /G
Am Ende: Architektur, Architekturzentrum Wien /D
Mahnmal für aktive Gewaltfreiheit, Linz (Wettbewerb) /P
Herwig Turk Landschaft=Labor, Museum Moderner Kunst
Klagenfurt (Kat.) /G
Ein stiller Begleiter, Großmugl /P
Seeing is believing, Museum Angerlehner, Wels (Kat.) /G
SUPER J’arrive, Super Wien /G - 2015
- Das Denkmal, Institut für Staatswissenschaften, Wien /V
Filmbau. Schweizer Architektur im bewegten Bild, SAM Schweizerisches
Architekturmuseum, Basel (Kat.) /G
Mehr als Zero, Hans Bischoffshausen, Österreichische Galerie Belvedere,
Wien (Kat.) /D
Fronteras En Cuestión II, Centro de Desarollo de las Artes Visuales,
Habana /G
Revers de Tromp, Akademie der bildenden Künste Wien /G
Das Denkmal, Parallel Vienna, Wien /G
Palm Capsule, Exposition Park, Los Angeles /P
Uncommon Places, Synthesis Gallery of Photography, Sofia /G
Fictitious Tales about the History of Earth, MAK Center, Los Angeles /G
Nicole Six & Paul Petritsch, Das Denkmal, Kunstraum Lakeside,
Klagenfurt /E
Mainzer Ansichten, Kunsthalle Mainz /E
The Visual Paradigm, Camera Austria, Graz /G
Vienna for Art`s Sake, Winter-Palast Belvedere, Wien (Kat.) /G - 2014
- Lichtblicke, Universitätskulturzentrum UNIKUM und section a, Trzic /G
Korrelation, Angewandte Innovation Laboratory, Wien /G
Wirklichkeit und Konstruktion, Stadtgalerie Klagenfurt (Kat.) /G
Die Gegenwart der Moderne, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig /V
Unframed, Galerie Raum mit Licht und Eikon, Wien /G
Archives, Re-Assemblances and Surveys, On Austrian Contemporary
Photography, Klovicevi dvori Gallery, Zagreb (Kat.) /G
Nicole Six und Paul Petritsch, Das Meer der Stille, Landesgalerie Linz (Kat.) /E
Fade into You, Kunsthalle Mainz /V
MAK Design Labor, MAK – Österreichisches Museum für angewandte
Kunst, Wien /G
Places of Transition, Freiraum – MuseumsQuartier Wien (Kat.) /D - 2013
- Suicide Narcissus, The Renaissance Society, Chicago /G
Gefährdung, Entzug und grundloses Aushalten, Transmediale Kunst -
Universität für angewandte Kunst, Wien /V
Vienna for Art`s Sake, Benetton Collection, Treviso (Kat.) /G
Kunstgastgeber – Rennbahnweg 27, KÖR Kunst im öffentlichen Raum,
Wien (Kat.) /P
Denkmal für die Verfolgten der NS-Miltärjustiz, Ballhausplatz 1010 Wien /P
Nebelland hab ich gesehen, Museum Moderner Kunst Klagenfurt (Kat.) /G
Is it really you, Kunstsammlung Oberösterreich, Linz /G
Praxis der Liebe, Salzburger Kunstverein, Salzburg /D
Das Bauhaus in Kalkutta, Bauhaus Dessau /D
Wolken, Welt des Flüchtigen, Leopold Museum, Wien (Kat.) /G
Schuss / Gegenschuss, in: Camera Austria, Nr. 121 /P - 2012
- Art is Concrete, Camera Austria, Graz /D
Sowjetmoderne, Architekturzentrum Wien /D
Aus, Schluss Basta oder Wir sind total am Ende, Schauspielhaus Graz /V
Keine Zeit, erschöpftes Selbst / entgrenzetes Können, 21er Haus,
Wien (Kat.) /G
Space Affairs, Musa, Wien /G
Aussicht kann durch Ladung verstellt sein, Kunstverein Medienturm,
Graz (Kat.) /E - 2011
- Im täglichen Wahnsinn den Zauber finden!, Kunstraum Goethestrasse
xtd, Linz /G
Schall und Rauch, die Vertikale und der freie Fall, TransArts - Universität
für angewandte Kunst, Wien /V
If a tree falls in the forest, and nobody hears it, does it make a sound?,
Galerie Lisa Ruyter, Wien /G
Das Ding an sich, Mariendom, Linz /P
Raum für 17 Minuten 6’23’’, Galerie im Taxispalais, Innsbruck (Kat.) /E
Prima Interventionen, Atelierhaus Salzamt, Linz /G
Proposals for Venice, Landesgalerie Linz (Kat.) /G - 2010
- Körper Codes, Museum der Moderne Salzburg /G
Der Aufstand der Zeichen, k48, Wien, Intervention im öffentlichen Raum /P
Heimat/Domovina, Museum Moderner Kunst Klagenfurt (Kat.) /G
Triennale Linz 1.0, Linz (Kat.) /G
Blind Date, Kunstverein Hannover /E
Atlas, Secession, Wien (Kat.) /E
Upon Arrival, Malta Contemporary Art, Malta (Kat.) /G - 2009
- Österreichischer Grafikwettbewerb (31) , Galerie im Taxispalais,
Innsbruck (Kat.) /G
Mahnmal für die Zwangsarbeitslager St. Pölten - Viehofen,
in Zusammenarbeit mit Jeanette Pacher (nicht realisiert) /P
Das menschliche und das tierische Wesen, Ursulinenkirche, Linz /E
Reading the City, ev+a 2009, Limerick (Kat.) /G
Spotlight, Museum der Moderne, Salzburg /G - 2008
- Undiszipliniert, Das Phänomen Raum in Kunst, Architektur und Design, Kunsthalle Exnergasse, Wien (Kat.) /G
Peter Zumthor, Bauten und Projekte 1986–2007 mit einer Filminstallation von Nicole Six & Paul Petritsch, Experimentadesign, Lissabon /P
zu Gironcoli, Gironcoli Museum, Herberstein /G
K08, Emanzipation und Konfrontation, Künstlerhaus Klagenfurt (Kat.) /G
Was ist ein Platz? Was ist ein Cy-BORG-Platz?, Temporäre Kunst im Stadtraum, Wiener Neustadt /P
unterwegs sein, Kunstraum Düsseldorf (Kat.) /G
Bildpolitiken, Salzburger Kunstverein, Salzburg /D
Kontakt...aus der Sammlung der Erste Bank-Gruppe, Institut
of Contemporary Art, Dunaújváros (Display) /D
zoom and scale, Akademie der bildenden Künste, Wien /G - 2007
- Max Ernst und die Welt im Buch, Museum der Moderne, Salzburg /G
Peter Zumthor, Bauten und Projekte 1986–2007 mit einer Filminstallation von Nicole Six & Paul Petritsch, KUB Kunsthaus Bregenz /P
Temporally, The Israeli Center for Digital Art, Holon /G
Margherita Spiluttini. Atlas Austria, Architekturzentrum Wien /D
Kunstverein Baden, Kunstverein Baden /G
Blickwechsel Nr.3, MMKK, Klagenfurt (Kat.) /G
I`m too tired to tell you, Agentur, Amsterdam /E
Film ab, Universität für Musik und darstellende Kunst, BIG, Wien /P
Kontakt Belgrad...aus der Sammlung der Erste Bank-Gruppe, Museum Moderner Kunst, Belgrad /D - 2006
- Longitude / Latitude, haaaauch, Klagenfurt /E
Nicole Six / Paul Petritsch, Gesellschaft für aktuelle Kunst, Bremen /E
First the artist defines meaning, Camera Austria, Graz /G
Société des nations, Circuit, Lausanne /G
How and Wow, Experimentelle Gestaltung Kunstuniversität Linz, Linz /V
Kontakt...aus der Sammlung der Erste Bank-Gruppe, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wien /D
Margherita Spiluttini. Atlas Austria, Architekturzentrum Wien mit Arco, Madrid /D - 2005
- Tu Felix Austria…Wild at Heart, KUB Kunsthaus Bregenz (Kat.) /G
Home Stories, Architekturzentrum Wien mit Austrian Cultural Forum,
New York /D
Das Spannende ist doch die Organisation von Materie, Area 53, Wien /G
Wisdom of Nature, Nagoya City Art Museum, Nagoya (Kat.) /G
Das Neue 2, Atelier im Augarten, Zentrum für zeitgenössische Kunst der Österreichischen Galerie Belvedere, Wien (Kat.) /G
Großmugl, Wettbewerb Kunst im öffentlichen Raum, Großmugl
(nicht realisiert) /P
Museums-Empfangsbereich, Frac Lorraine, Metz, Frankreich /P
Slices of Life, blueprints of the self in painting, Austrian Cultural Forum,
New York /D - 2004
- Open Studio, ISCP, New York /G
Transgressing-Systems, Ausstellen zu Bauen und Kunst, Innsbruck /G
1.33.33, Area 53, Wien /G
Permanent Produktiv, Kunsthalle Exnergasse, Wien /G
White Spirit in Public Spaces, F.R.A.C. de Lorrain, Metz /G
The Austrian Phenomenon / Konzepte Experimente Wien Graz 1958-1973, Architekturzentrum Wien /D - 2003
- Fata Morgana, Wettbewerb Silos Graz-West, Kulturhauptstadt Graz 2003
in Zusammenarbeit mit Jeanette Pacher (nicht realisiert) /P
Flutlichtmast, Wettbewerb Kunst im öffentlichen Raum in Rohrendorf
in Zusammenarbeit mit Hans Schabus (nicht realisiert) /P
Trauer, Atelier im Augarten, Zentrum für zeitgenössische Kunst der Österreichischen Galerie Belvedere, Wien (Kat.) /G
America, bgf_plattform, Berlin /G
Extended Architecture, Tanzwerkstatt Europa, Neues Theater, München /G
just build it! Die Bauten des Rural Studio, Architekturzentrum Wien /D
site-seeing: disneyfizierung der städte, Künstlerhaus Wien /D - 2002
- artists´choice, CAT Contemporary Art Tower – MAK
Gegenwartskunstdepot, Wien /E
space off, supersaat, Wien /G - 2001
- moving out, Universität für angewandte Kunst, Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien /D
/E Einzelausstellungen
/G Gruppenausstellungen
/P Projekte: Intervention, öffentlicher Raum, Wettbewerbe oder realisiert Projekte
/D Display: Ausstellungen, Katalog
/V Vorträge u. Screening, Präsentation
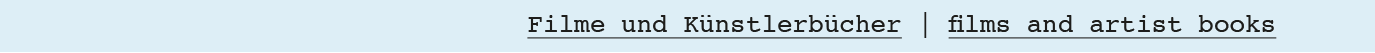
- FILMS
- 2024
- Seemeile (Sumbu und Pekel)
Video with sound
one-channel projection
20 min 49 sec, colour
Die Reise der Bilder
Video with sound
eight-channel projection
24 min 24 sec - 33min 23 sec, colour - 2023
- Lueger Temporär
Video with sound
one-channel projection
22 min 11 sec, colour
05.01.2023 (Pečnikov travnik/Pečnik-Wiese)
Video with sound
four-channel projection
1h 50min, colour - 2021
- Pilot
(Dialogisch den Horizont expandieren - von Klagenfurt nach Klagenfurt)
Video with sound
one-channel projection
11 min 08 sec, colour
Roxy, 27.05.2021 (Block Beuys)
Video with sound
one-channel projection
8 min 12 sec, colour - 2020
- Parallel Worlds
20.03.2020 / 01.04.2020 / 20.04.2020
Video with sound
three-channel projection
23 min 12sec, colour - 2017
- Ohne Titel (Albaner Hafen)
Video with sound
three-channel projection
51 min, colour - 2015
- Das Denkmal
Video with sound
two-channel projection
130 min, colour - 2014
- Raum für 5’16’’
Video with sound
two-channel projection
5 min 16 sec, colour
Das Meer der Stille
Video with sound on DVD
3 min 34 sec, colour - 2011
- Raum für 17 Minuten 6’23’’
Video with sound
two-channel projection
6 min 23 sec, colour - 2009
- Das menschliche und das tierische Wesen
Video with sound
five-channel projection
19 min, colour - 2007
- Ohne Titel, twelve buildings by Peter Zumthor
Video with sound
six-channel projection
480 min, colour
Nebel
Video with sound on DVD
30 min, colour - 2005
- Ohne Titel, Kunsthaus Bregenz
Video with sound on DVD
six-channel projection
72 h, colour
I’m too tired to tell you
Video on DVD
17 min, colour, silent - 2004
- Longitude / Latitude
Video on DVD
77 min, colour, silent
Raum
Video with sound on DVD
60 min, colour - 2003
- Camera dead
Video with sound on DVD
35 sec, colour
Räumliche Maßnahme (2)
Video with sound on DVD
two-channel projection
50 min, colour - 2002
- Räumliche Maßnahme (1)
Video with sound on DVD
28 min, colour
ARTISTS BOOKS (EDITIONS)
- 2021
- Roxy, 27.05.2021 (Block Beuys)
Hessisches Landesmuseum Darmstadt (Hg.),
Edition: 10+2 - 2020
- Unplugged
David Korecky, Galerie Rudolfinum (eds.), Prague
Edition: 99 - 2018
- Lost and Found
Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna
Edition: 8+2 - 2016
- Fotoarchiv 30.06.2016-26.04.2015
Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna
Edition: 20+2 - 2015
- Fotoarchiv 26.04.2015-06.05.2014
Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna
Edition: 20+2 - 2014
- Das Meer der Stille
Landesgalerie Linz / Barbara Schröder (eds.), Linz
Fotoarchiv 14.04.2014-10.07.2012
Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna
Edition: 20+2 - 2012
- Aussicht kann durch Ladung verstellt sein
Kunstverein Medienturm (eds.), Graz
Edition: 20+2
Fotoarchiv 20.04.2012-09.03.2010
Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna
Edition: 20+2 - 2011
- Raum für 17 Minuten 6’23
Galerie im Taxispalais (eds.), Innsbruck - 2010
- Atlas
Nicole Six und Paul Petritsch, Secession (eds.), Vienna
Edition: 20+2
Fotoarchiv 20.02.2010-17.10.2009
Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna
Edition: 20+2
Innere Grenze
Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna
Edition: 3+2 - 2009
- Fotoarchiv 28.09.2009-7.10.2008
Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna
Edition: 20+2 - 2008
- Fotoarchiv 05.10.2008-16.02.2007
Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna
Edition: 20+2 - 2007
- Fotoarchiv 21.01.2007-07.09.2005
Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna
Edition: 20+2 - 2005
- Fotoarchiv 16.08.2005-04.08.2004
Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna
Edition: 20+2 - 2004
- Fotoarchiv 06.06.2004-15.02.2001
Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna
Edition: 20+2
Raumbuch
Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna
Edition: 3+2
FILME
- 2024
- Seemeile (Sumbu und Pekel)
Video, 1 Kanal
20 min 49 sec
Ton, Farbe
Die Reise der Bilder
Video, 8 Kanal
24 min 24 sec - 33min 23 sec, Ton, Farbe - 2023
- Lueger Temporär
Video, 1 Kanal
22 min 11 sec, Ton, Farbe
05.01.2023 (Pečnikov travnik/Pečnik-Wiese)
Video, 4 Kanal
1h 50min, Ton, Farbe - 2021
- Pilot
(Dialogisch den Horizont expandieren
- von Klagenfurt nach Klagenfurt)
Video, 1 Kanal
11 min 08 sec, Ton, Farbe
Roxy, 27.05.2021 (Block Beuys)
Video, 1 Kanal
8 min 12 sec, Ton, Farbe - 2020
- Parallel Worlds
20.03.2020 / 01.04.2020 / 20.04.2020
Video, 3 Kanal
23 min 12sec, Ton, Farbe - 2017
- Ohne Titel (Albaner Hafen)
Video
3 Kanal Projektion
51 min, Farbe, Ton - 2015
- Das Denkmal
Video
2 Kanal Projektion
130 min, Farbe, Ton - 2014
- Raum für 5’16’’
Video
2 Kanal Projektion
5 min 16 sec, Farbe, Ton
Das Meer der Stille
Video
3 min 34 sec, Farbe, Ton - 2011
- Raum für 17 Minuten 6’23’’
Video
2 Kanal Projektion
6 min 23 sec, Farbe, Ton - 2009
- Das menschliche und das tierische Wesen
Video
5 Kanal Projektion
19 min, Farbe, Ton - 2007
- Ohne Titel, 12 Bauten von Peter Zumthor
Video
6 Kanal Projektion
480 min, Farbe, Ton
Nebel
Video auf DVD
30 min, Farbe, Ton - 2005
- Ohne Titel, Kunsthaus Bregenz
Video auf DVD
6 Kanal Projektion
72 h, Farbe, Ton
I’m too tired to tell you
Video auf DVD
17 min, Farbe, ohne Ton - 2004
- Longitude / Latitude
Video auf DVD
77 min, Farbe, ohne Ton
Raum
Video auf DVD
60 min, Farbe, Ton - 2003
- Camera dead
Video auf DVD
35 sec, Farbe, Ton
Räumliche Maßnahme (2)
Video auf DVD
2 Kanal Projektion
50 min, Farbe, Ton - 2002
- Räumliche Maßnahme (1)
Video auf DVD
28 min, Farbe, Ton
ARTISTS BOOKS (EDITIONS)
- 2021
- Roxy, 27.05.2021 (Block Beuys)
Hessisches Landesmuseum Darmstadt (Hg.),
Edition: 10+2 - 2020
- Unplugged
David Korecky, Galerie Rudolfinum (Hg.), Prag
Edition: 99 - 2018
- Lost and Found
Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien
Edition: 8+2 - 2016
- Fotoarchiv 30.06.2016-26.04.2015
Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien
Edition: 20+2 - 2015
- Fotoarchiv 26.04.2015-06.05.2014
Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien
Edition: 20+2 - 2014
- Das Meer der Stille
Landesgalerie Linz / Barbara Schröder (Hg.), Linz
Fotoarchiv 14.04.2014-10.07.2012
Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien
Edition: 20+2 - 2012
- Aussicht kann durch Ladung verstellt sein
Kunstverein Medienturm (Hg.), Graz
Edition: 20+2
Fotoarchiv 20.04.2012-09.03.2010
Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien
Edition: 20+2 - 2011
- Raum für 17 Minuten 6’23
Galerie im Taxispalais (Hg.), Innsbruck - 2010
- Atlas
Nicole Six und Paul Petritsch, Secession (Hg.), Wien
Edition: 20+2
Fotoarchiv 20.02.2010-17.10.2009
Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien
Edition: 20+2
Innere Grenze
Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien
Edition: 3+2 - 2009
- Fotoarchiv 28.09.2009-7.10.2008
Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien
Edition: 20+2 - 2008
- Fotoarchiv 05.10.2008-16.02.2007
Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien
Edition: 20+2 - 2007
- Fotoarchiv 21.01.2007-07.09.2005
Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien
Edition: 20+2 - 2005
- Fotoarchiv 16.08.2005-04.08.2004
Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien
Edition: 20+2 - 2004
- Fotoarchiv 06.06.2004-15.02.2001
Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien
Edition: 20+2
Raumbuch
Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien
Edition: 3+2
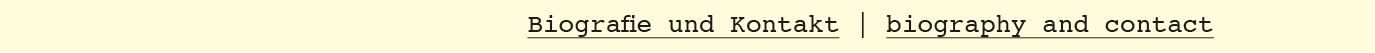
Nicole Six and Paul Petritsch have been realizing films, photographs, displays, artist books as well as site- and context-specific installations and projects in public space since 1997. They live in Vienna.
They explore the limits of our existence and our perception with expeditions into everyday life, through oceans, polar regions, concrete deserts as well as lunar landscapes. With their experimental test arrangements and interventions, they locate themselves and the viewer again and again in art spaces, architectures and landscapes.
BIOGRAPHY
Nicole Six
Born 1971 in Vöcklabruck, Austria
Academy of fine Arts Vienna, Sculpture
Paul Petritsch
Born 1968 in Friesach, Austria
University of Applied Arts Vienna, Architecture
1997 MAK Schindler Scholarship, Los Angeles
2004 International Studio & Curatorial Program / ISCP, New York
2005 Visiting Professor at Experimental Design, Kunstuniversität Linz
2006 State Fellowship for Fine Arts
2007 Kardinal König Art Award
2008 T-mobile Art Award
2008 Lectureship Modul Kunsttransfer, Institut für Kunst und Gestaltung, Vienna
2009 Austrian drawing Award
2011 - 2020 Member of the panel BIG Art – Kunst und Bau der BIG (Nicole Six)
2014 since 2014 Head of the Department Site-Specific Art, University of Applied Arts Vienna (Paul Petritsch)
2015 Member of the panel Kunsthalle Exnergasse (Paul Petritsch)
2017 Karl-Anton-Wolf-Award
2019 since 2019 board member of Camera Austria, Graz (Nicole Six)
2021 Guest professor of the Department Site-Specific Art, University of Applied Arts Vienna (Nicole Six)
2023 Lectureship at the department Kunst und Musik, Kunst und Kunsttheorie, University of Cologne (Nicole Six)
2023 Landeskulturpreis für Bildende Kunst, Upper Austria
2024 board member of Camera Austria, Graz (Nicole Six)
Landeskulturpreis für Bildende Kunst, Lower Austria
Collaboration since 1997
KONTAKT
Nicole Six and Paul Petritsch
Schottenfeldgasse 76/25
1070 Vienna/Austria
Tel. +43 1 95797 99
Fax +43 1 95797 99
Mail: office@six-petritsch.com
Nicole Six und Paul Petritsch realisieren seit 1997 gemeinsam Filme, Fotografien, Displays, Künstlerbücher sowie orts- und kontextspezifische Installationen und Projekte im öffentlichen Raum. Sie leben in Wien.
Die Grenzen unseres Daseins und unserer Wahrnehmung erforschen sie mit Expeditionen in den Alltag, durch Ozeane, Polarregionen, Betonwüsten, wie auch Mondlandschaften. Mit ihren experimentellen Versuchsanordnungen und Eingriffen verorten sie sich und die Betrachter*innen immer wieder neu in Kunsträumen, Architekturen und auch Landschaften.
BIOGRAFIE
Nicole Six
1971 geboren in Vöcklabruck, Österreich
Studium der Bildhauerei an der Akademie der bildenden Künste
Paul Petritsch
1968 geboren in Friesach, Österreich
Studium der Architektur an der Universität für Angewandte Kunst
1997 Schindlerstipendium
2004 ISCP, New York
2005 Gastprofessur am Institut für Experimentelle Gestaltung, Kunstuni Linz
2006 Staatsstipendium für bildende Kunst
2007 Kardinal König Kunstpreis
2008 T-mobile Art Award
2008 Lehrauftrag Modul Kunsttransfer, Institut für Kunst und Gestaltung, TU Wien
2009 Österreichischer Grafikwettbewerb
2011 - 2020 Jurymitglied von BIG Art – Kunst und Bau der BIG (Nicole Six)
2014 seit 2014 Leitung Abteilung für ortsbezogene Kunst, Universität für Angewandte Kunst (Paul Petritsch)
2015 Künstlerischer Beirat der Kunsthalle Exnergasse (Paul Petritsch)
2017 Karl-Anton-Wolf-Preis
2019 seit 2019 Vorstandsmitglied der Camera Austria, Graz (Nicole Six)
2021 Gastprofessorin Abteilung für ortsbezogene Kunst, Universität für Angewandte Kunst (Nicole Six)
2023 Lehrauftrag am Department Kunst und Musik, Kunst und Kunsttheorie, Universität zu Köln (Nicole Six)
2023 Landeskulturpreis für Bildende Kunst, Oberösterreich
2024 Vorstandsmitglied der Camera Austria, Graz (Nicole Six)
Landeskulturpreis für Bildende Kunst, Niederösterreich
Zusammenarbeit seit 1997
KONTAKT
Nicole Six und Paul Petritsch
Schottenfeldgasse 76/25
1070 Wien/Österreich
Tel. +43 1 95797 99
Fax +43 1 95797 99
Mail: office@six-petritsch.com
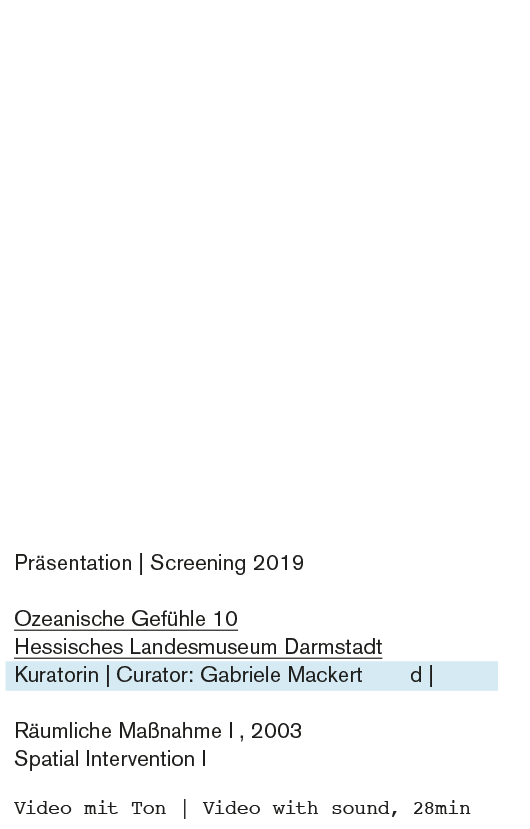



A person stands on the ice and breaks a hole in the frozen surface, determinedly swinging the pick axe again and again. A dark and indistinct figure against the nebulous horizon. We sense that its ambition is about to backfire. A hardly spectacular act, absurd and dangerous nevertheless. What is this person looking for? What does it hope to uncover? Is it forging a path to somewhere?
Strongly sensuous qualities emanate from the tension between the solitary figure, its irrational activity, and the eeriness of the seemingly infinite natural setting evoked by the lack of a horizon and the wispy fog. This sublimity is disrupted by human activity. The figure is not working against nature; rather, it is intent on bringing about its own destruction. We as viewers are witnessing a deliberate disappearance. Ultimately, the hole in the ice will become a kind of window leading out of the image space, out of the video. Into the black void.
Eine Person steht auf der Eisfläche und schlägt ein Loch. Unbeirrt holt sie immer wieder mit ihrer Spitzhacke aus. Sie hebt sich dunkel vom nebligen Horizont ab. Sie wird sich - so ahnt man bald - ganz real selbst den Boden unter den Füßen wegziehen. Als Aktion nicht spektakulär, jedoch aberwitzig und gefährlich. Was sucht sie? Was will sie freilegen? Wohin vorstoßen?
Die Spannung zwischen dem Einsamen, ihrer widersinnigen Handlung und der durch den fehlenden Horizont und leichten Nebel gespenstisch unendlich erscheinenden Natur verbreitet enorme sinnliche Qualitäten. Diese Erhabenheit wird durch das menschliche Verhalten gestört. Zwar arbeitet sie nicht gegen die Natur, aber sie betreibt konzentriert den eigenen Untergang. Wir als Betrachter werden Zeugen eines vorsätzlichen Verschwindens. Das Loch im Eis wird am Ende auch eine Art Fenster hinaus aus dem Bildraum, aus dem Video. Ins schwarze Nichts.



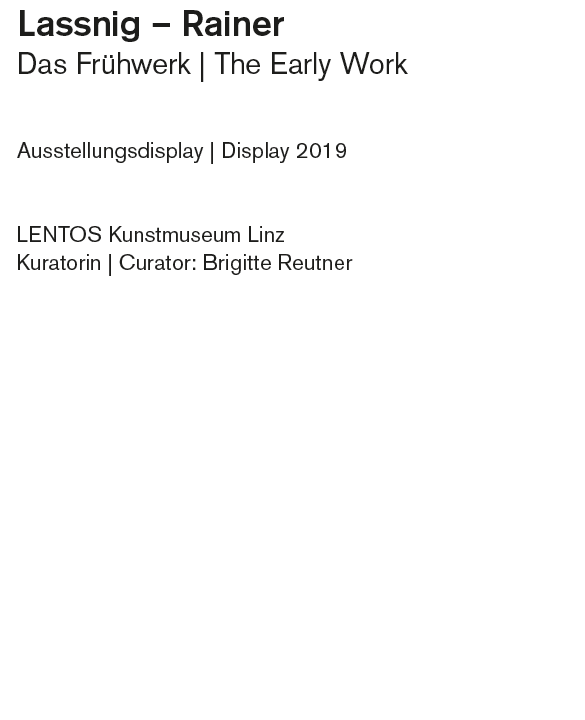
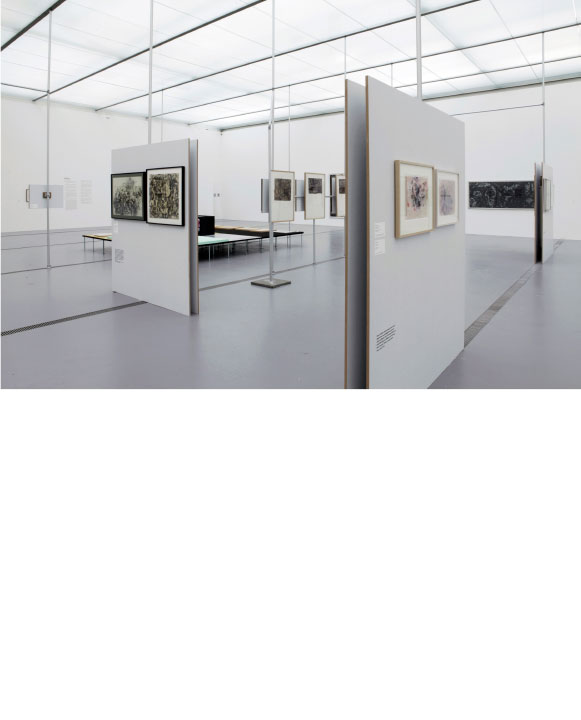



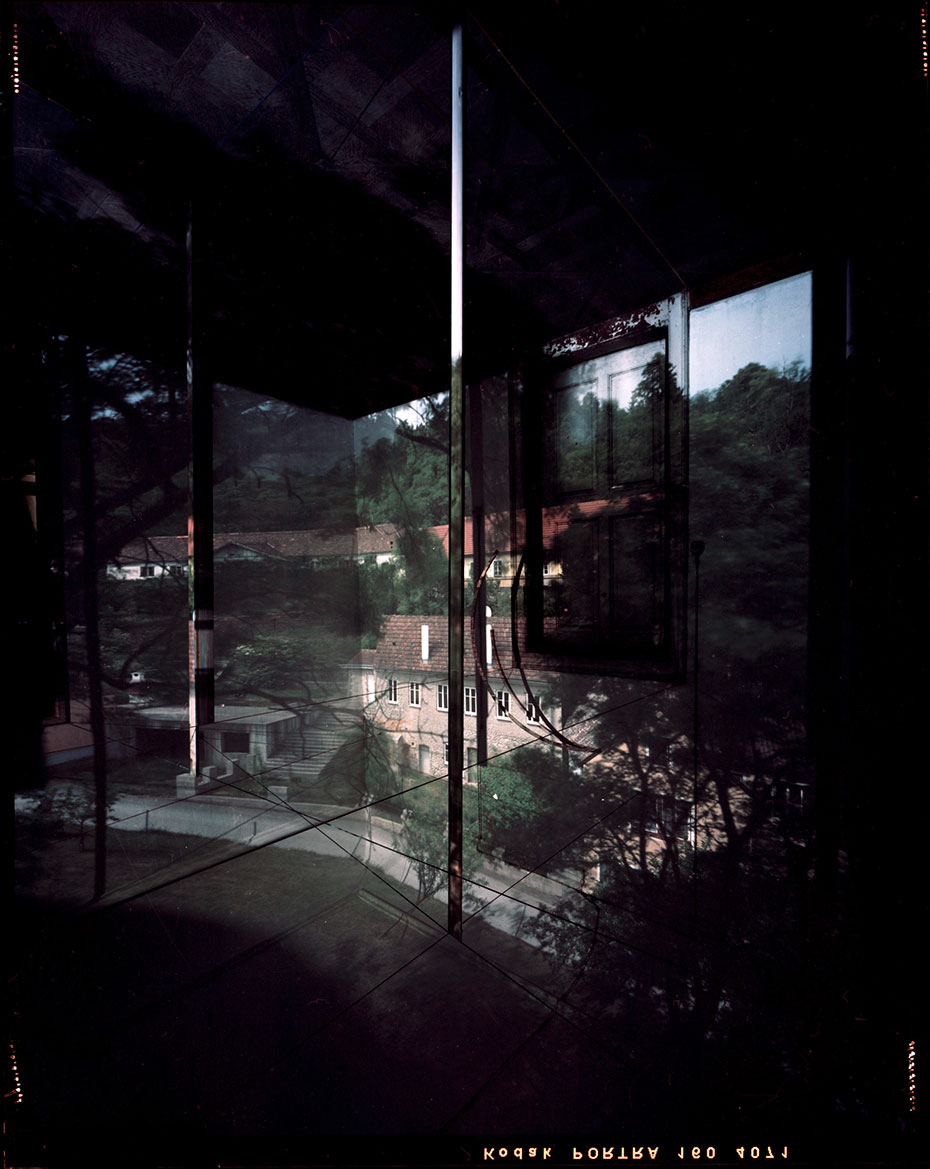
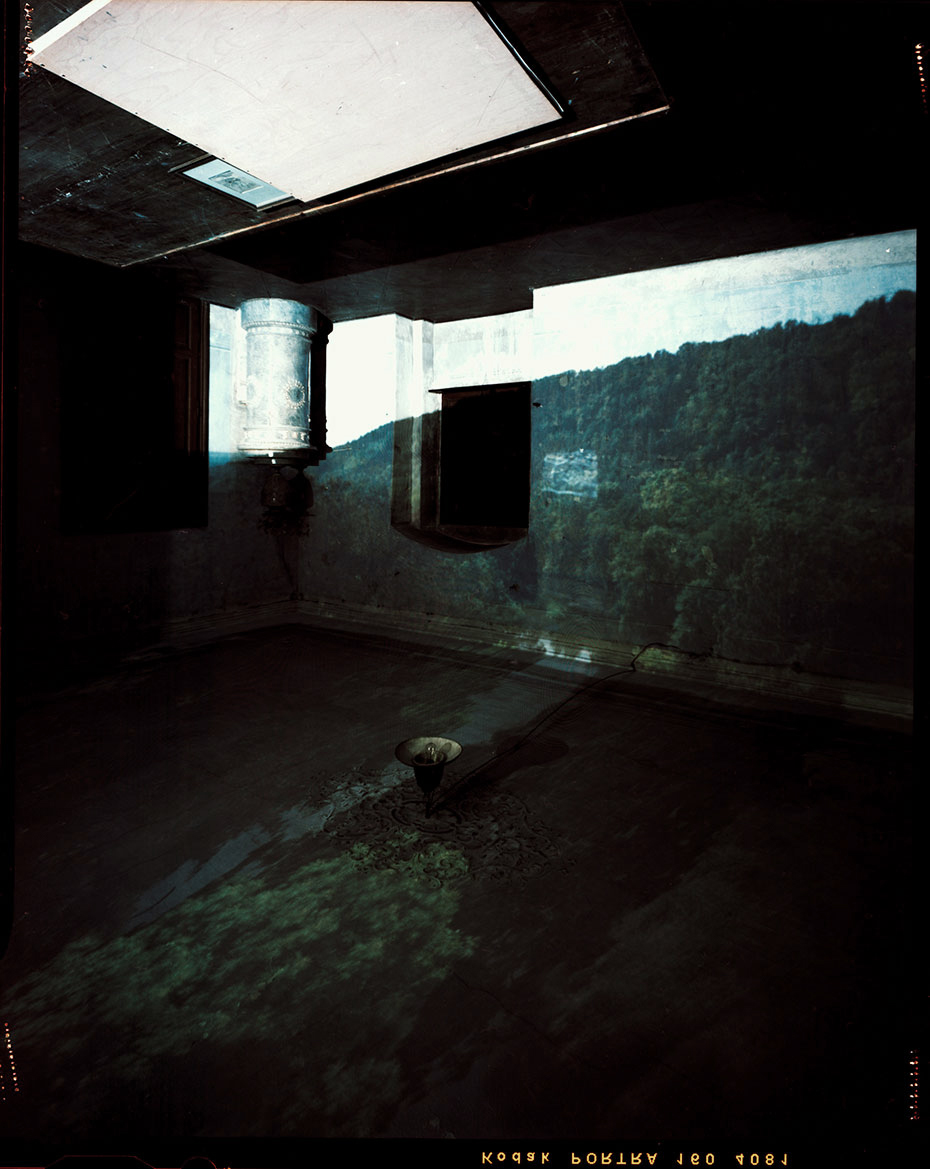
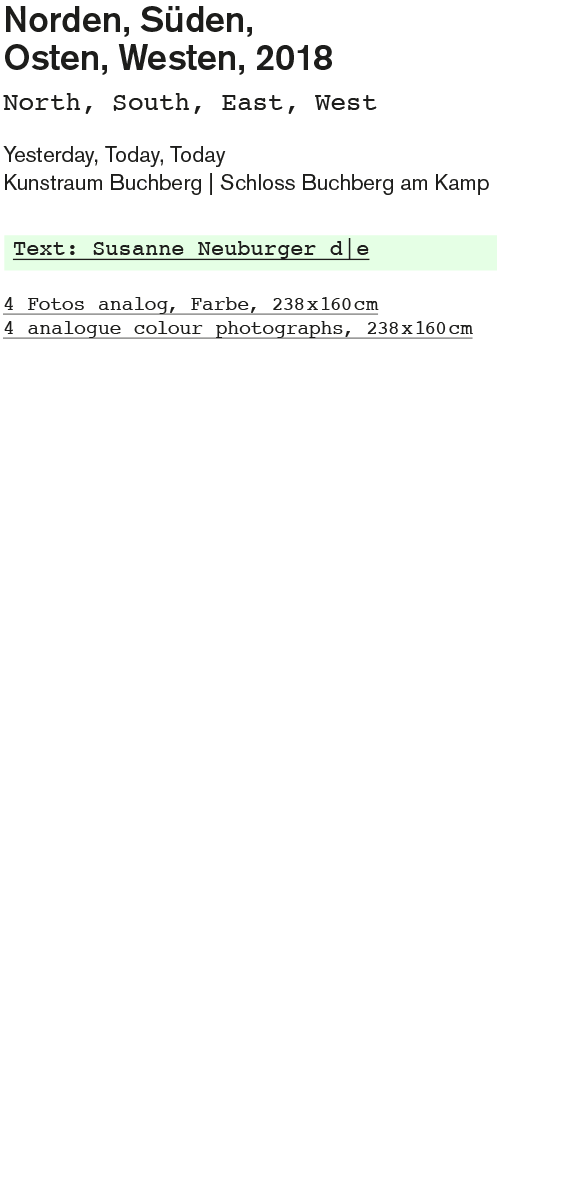


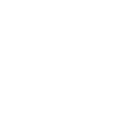
Norden, Süden, Osten, Westen
Nicole Six and Paul Petritsch´s work at Buchberg began with an in-depth spatial examination with regard to the axes of the castle, including a topographic exploration of the surroundings of the building. In what can be described as a ‘concentrated, closed situation’ (Six/Petritsch) and by resorting to photography, the artists eventually condensed the huge dimensions of their experiment by linking it to the morethan 2000-year-old principle of the camera obscura. At each of four points in the castle facing north, east, south, and west, they installed a camera obscura in a darkened room, its image falling in from the outside—mirrorinverted and upside down—overlapping with the interior space and exhibiting ascertainable details frequently giving a technoid impression on the one hand and revealing pictorially poetic moments on the other, which Six/Petritsch captured as photographs. These have now been installed in three rooms of the castle. In the pictures, the wide expanse of the exterior seems to correspond with the seclusion of the interiors; similarly, the camera obscura was once considered a private and place of retreat and contemplation of the world that harboured a huge experimental potential.
Norden, Süden, Osten, Westen
Am Beginn der Arbeit von Nicole Six und Paul Petritsch in Buchberg stand eine umfassende Raumuntersuchung in Bezug auf die Achsen des Schlosses mit einer topographischen Erkundung der Umgebung des Gebäudes. Mit einem Rekurs auf die Fotografie in eine „konzentrierte, geschlossene Situation“ (Six/Petritsch) haben die Künstler das weite Versuchsfeld schließlich verdichtet und mit dem über 2000 Jahre alten Prinzip der Camera Obscura verbunden. An vier Punkten im Schloss, die jeweils nach Norden, Osten, Süden und Westen orientiert waren, installierten sie in abgedunkelten Räumen eine Camera Obscura, deren von außen einfallendes Bild sich – seitenverkehrt und am Kopf stehend – mit dem Innenraum überlagerte und einerseits registrarisch erfassbare, oft technoid wirkende Details erkennen ließ, andererseits bildhafte poetische Momente hervorbrachte, die Six/Petritsch als Fotografien festhielten. Sie sind nun auf drei Räume im Schloss verteilt. In den Bildern scheint die Weite des Außenraums mit der Abgeschlossenheit der Innenräume zu korrespondieren, wie die Camera Obscura ehemals als ein privater Ort von Rückzug und Weltbetrachtung angesehen wurde, der ein großes experimentelles Potential in sich birgt.
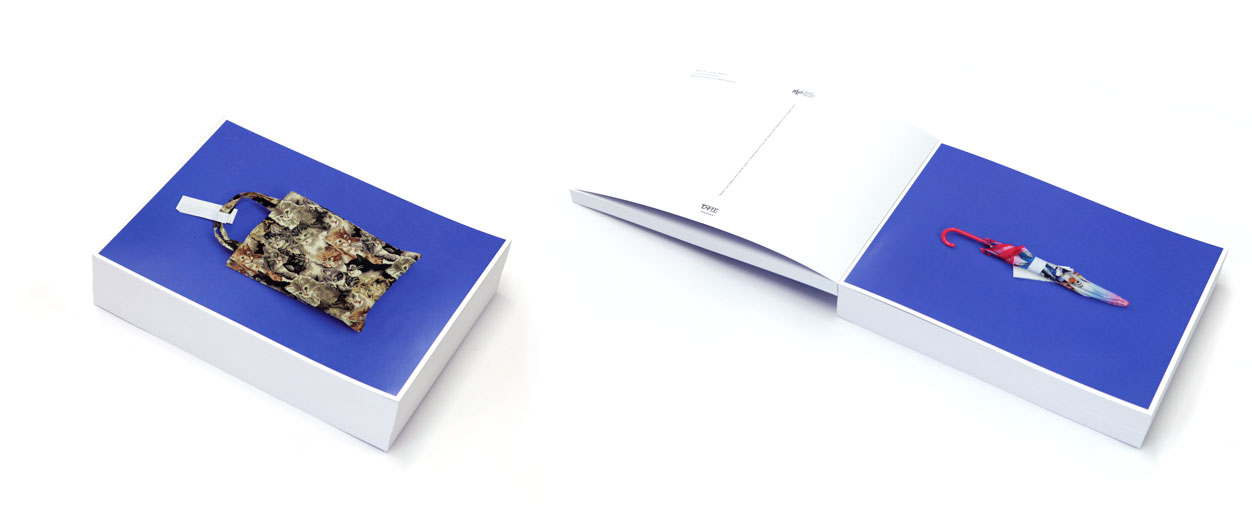
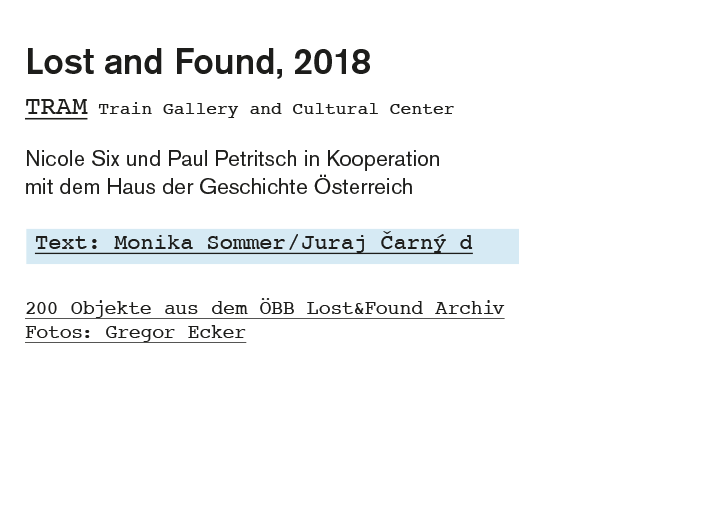

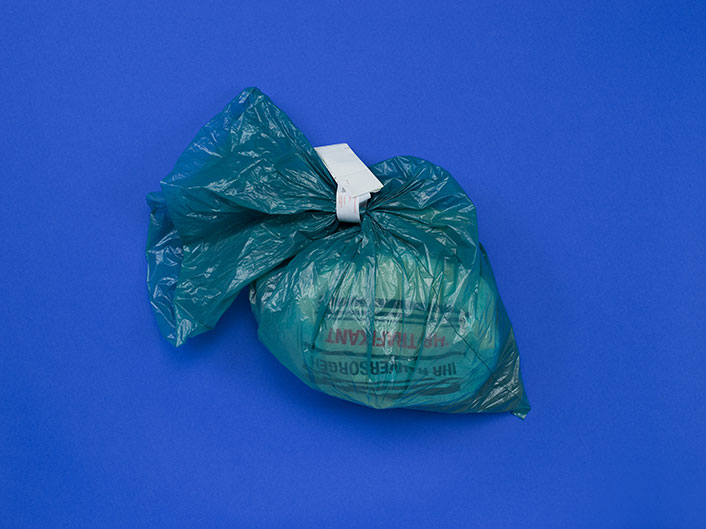


Lost and Found
Sometimes things get left behind in trains; sometimes things from history get left behind. “Lost and Found” by Six/Petritsch draws a remarkable connection between the Lost & Found offices of the Austrian Railways (ÖBB) and the House of Austrian History (HdGÖ): Both deal with objects that have their own special stories, stories written by life. Who decides which items are worthless and which have meaning?
Monika Sommer, Haus der Geschichte Österreich (HdGÖ)
Lost and Found
Manchmal bleiben Dinge in Zügen zurück, manchmal werden Dinge von der Geschichte zurückgelassen. "Lost and Found" von Six / Petritsch stellt eine außergewöhnliche Beziehung zwischen dem ÖBB-Fundbüro Lost & Found und dem Haus der Geschichte Österreich her: Beide haben es mit Dingen zu tun, die ihre besondere Geschichten haben, Geschichten, die vom Leben geschrieben wurden. Wer entscheidet, welche Dinge wertlos sind und welche Bedeutung tragen?
Monika Sommer, Haus der Geschichte Österreich
Gab es jemals in Ihrem Leben einen Gegenstand, der Ihnen so teuer war, dass Sie ihn niemals aufgeben wollten? War er Ihnen so wichtig, dass Sie ihn am liebsten im Tresor aufbewahren oder in die Sammlung Ihres Privatmuseums aufnehmen wollten? Und hatten Sie das Pech, dass er Ihnen verloren ging oder gestohlen wurde? Wenn ja, sind Sie hier richtig. Wenn nicht, dann ebenfalls. Willkommen in der Ausstellung Lost and Found, die von Nicole Six & Paul Petritsch für den Kunst-Zug TRAM gestaltet wurde. Charakteristisch für das Künstlerduo ist sein sensibler Umgang mit dem Umfeld in ortsspezifischen und kontextsensitiven Installationen.
Derzeit entsteht in Wien ein neues Museum, das Haus der Geschichte Österreich, in dem Sie die bedeutsamen Objekte aus Ihrer Vergangenheit vielleicht finden. Wenn nicht, können Sie sich ans Fundbüro wenden. Nicole Six & Paul Petritsch zeigen Gegenstände, die in Zügen und auf Bahnhöfen verloren gingen und gefunden wurden, in unauffälliger Konfrontation mit Museumsexponaten. Auf der einen Seite ein Gegenstand, der jemanden abhandengekommen ist und vielleicht nie mehr seinem Daseinszweck zugeführt werden kann, auf der anderen Seite ein Artefakt, das gesetzlich geschützt und in einem Depot des Museums in der Wiener Hofburg eingeschlossen ist. Ein Gegenstand, der seinen Besitzer und seine Geschichte verloren hat, in Konfrontation mit einem Exponat mit dokumentierter Geschichte. Ausgelöschte Erinnerung versus zeit- und ortsspezifisches Erinnerungsstück. Was haben Sie heute im Zug vergessen?
Juraj Čarný, TRAM Train Gallery and Cultural Center

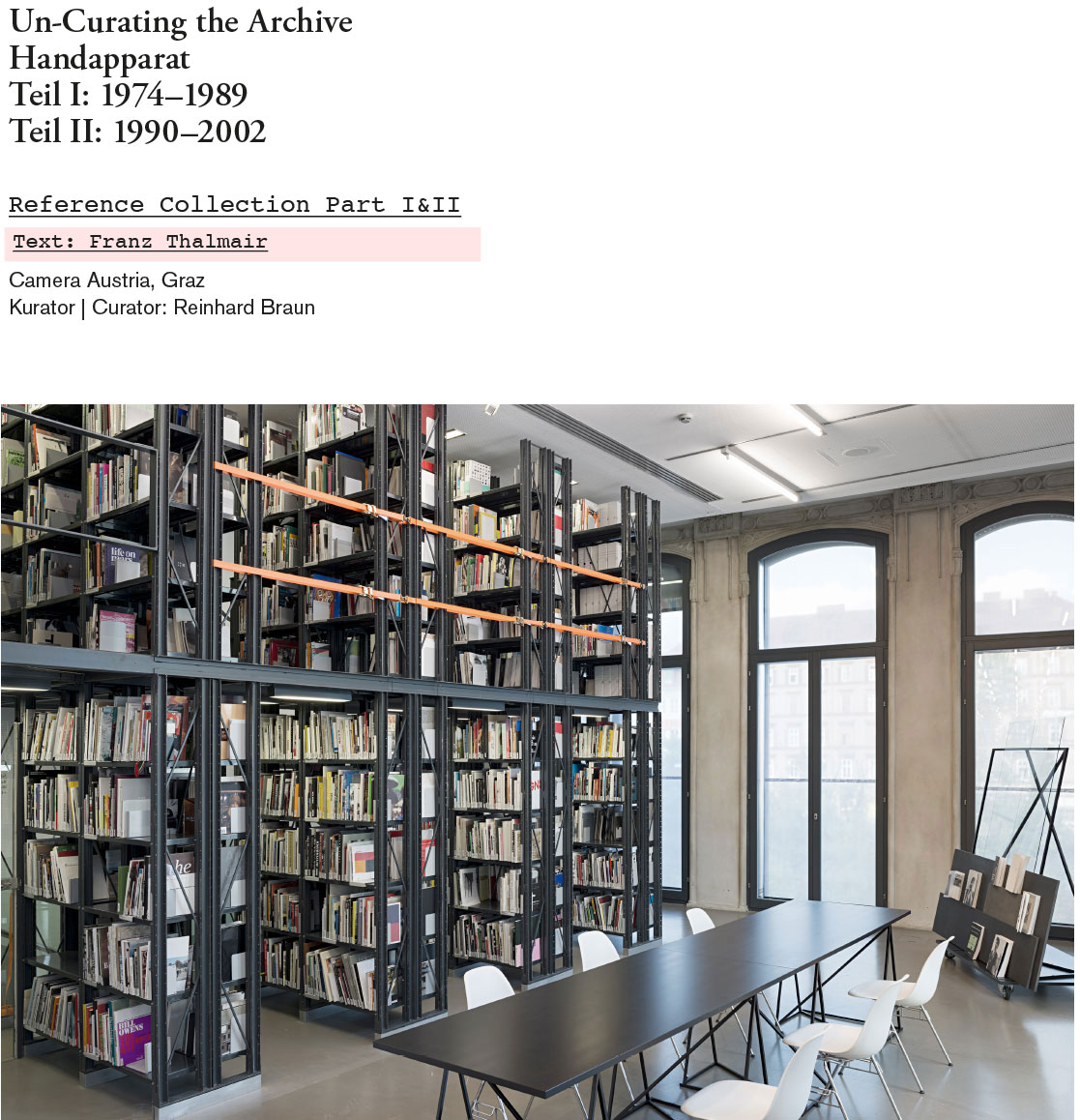
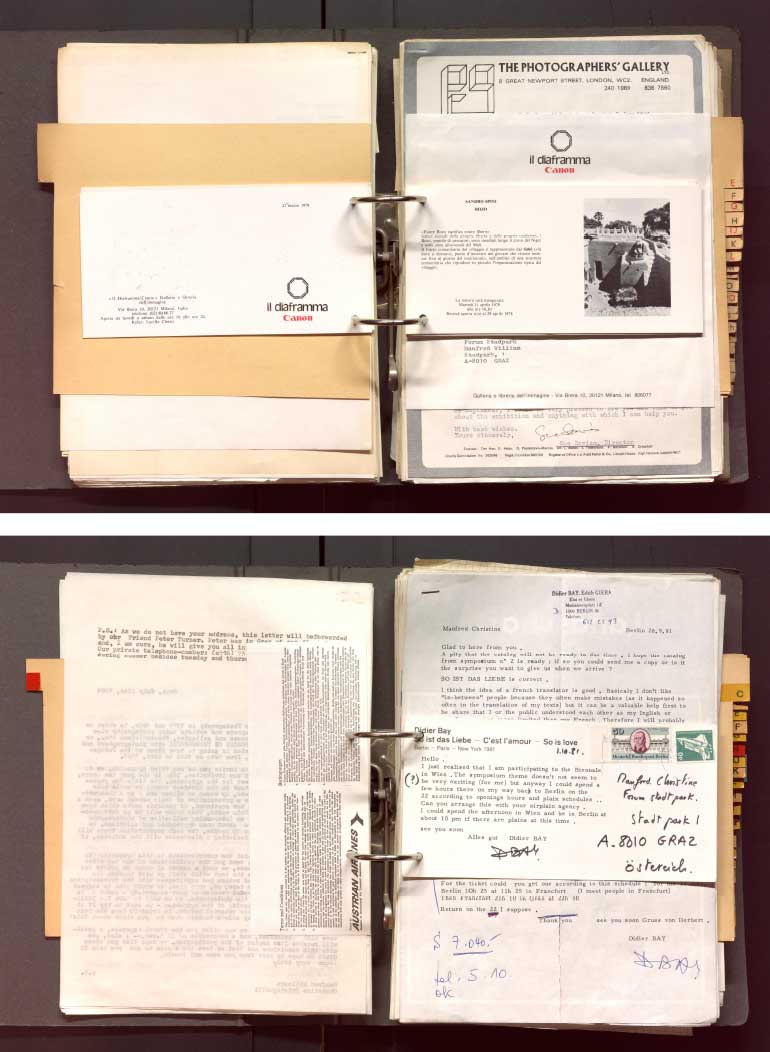

Un-Curating the Archive
Handapparat, 2017
Binder for binder, page for page, document for document. In Un-Curating the Archive Nicole Six and Paul Petritsch have digitized Camera Austria’s entire archive including each at first glance seemingly insignificant detail – then printed and bound this material in its found arrangement, and presented the books in the exhibition space according to the original ordering criteria. Everything. Countless data, numbers, correspondences, notes, invitation cards, research findings, lists of items, exhibition ideas, and loan contracts from 1974 to 1989, all this was barely processed by Six/Petritsch. And yet much has changed through the artist duo’s intervention into the archive of an exhibition-space-and-storeroom hybrid, of an institution whose focus lies in the field of photography and which has itself through its activity inscribed itself in countless archives and libraries.
“Un-curating” is how the artist duo describes what it is doing and at the same time not doing with this accumulation of binders, with this more or less already structured stack of notes: a viewing of the material, a putting into form, a preparing and making available, a selecting and showing. For Un-Curating the Archive, for this hybrid form of research, intervention, and installation, the artists have selected everything and brought everything together using the medium of the exhibition. What we therefore have here is a special form of curatorial practice, a curatorial sphere of action that conceives the exhibition not only as a means of presenting an experimental or research process but also as the site of the actual research, or in the words of the curator Simon Sheikh: “The curatorial project—including its most dominant form, the exhibition—should thus not only be thought of as a form of mediation of research but also as a site for carrying out this research, as a place for enacted research. Research is not only that which comes before realisation but also that which is realised throughout actualisation. That which would otherwise be thought of as formal means of transmitting knowledge—such as design structures, display models and perceptual experiments—is here an integral part of the curatorial mode of address, its content production, its proposition.”[1] Un-Curating the Archive does not stop at reflecting on sociopolitical factors and conveying the artistic questions and photographic themes that have been addressed by Camera Austria since its founding. The working in and working with a corpus whose potential still lies dormant is the underlying motivation behind making the found material available in its entirety.
With each examination of the Camera Austria archive, a new narration, a new journal article, a new exhibition might be developed from the collection of data: stories about artistic spheres of action and biographies, stories about the digitization process of photography since the mid 1970s, stories about the connections and relationships between the people involved – stories extracted in an exhibition that as such can only inadequately reproduce what makes an institution like Camera Austria what it is. In Un-Curating the Archive Nicole Six and Paul Petritsch confront such a decision between entire view and detail – between macro and micro photograph – and in the same moment they avoid it by withholding their books from the viewer, depriving the readers of the reproduced archivalia. This applies not only to a subjective thematic selection or a supposedly objective overview of the material; Six/Petritsch go a step further. By making available their entire research instrumentarium, their tools, the artists give the viewers the chance to extract their own stories from the reproduced materials, develop their own questions, interpret their own connections, ultimately letting each viewer produce his or her own story of an institution. This fundamental performative aspect under which artistic spheres of action like those of Un-Curating the Archive can be grouped are described by Hanne Seitz as follows: “The research aim wants neither to capture reality in images nor describe it in words, neither to test hypotheses nor let itself be guided by preconceived questions, nor does it intend to document any processes. It wants to be identical with the practice itself, to activate implied knowledge and generate new information in processing, applying, and handling this practice […] – Research in the field of art which, while being conducted, provides knowledge and absolutely sheds light on habitualized inscriptions”[2] Thus, binder for binder, page for page, document for document Un-Curating the Archive reveals an institution to the viewer– a potential waiting to be discovered, tapped, and fully exhausted, a potential space that the artist duo has turned into the actual protagonist of its work.
Nicole Six and Paul Petritsch have created a 1:1 scale digitization of the archive, bound it, and put it on display. What viewers, however, are presented with in Un-Curating the Archive as an installation with books, tables, a display stand, and a spatial intervention can no longer be considered an archive because the process of the simple but complete reproduction of all data has transformed the loose conglomeration of Camera Austria’s correspondences, notes, invitation cards, lists of items, and other documents and papers from an archive into a library. If we differentiate between archive and library, the biggest distinction between the two institutions lies in the items of the collection: “the library contains works, in other words inherently ordered artifacts and data storage mediums which were created to remember. The archive, in contrast, compiles unprocessed objects, which have in no way been created to remember, ‘raw’ data, ‘unmediated’ past, the real.”[3]
But while Six/Petritsch use the existing order of the archive materials to create a superordinate structure for their library, the material density and the intransparency of the archive in Un-Curating the Archive remains intact – a staging through which the intervention becomes an artistic work. In the end, in a way analogous to Camera Austria, to this cross between exhibition space and storeroom, the installation may also be seen as a hybrid that defies more precise ascriptions: a manifestation of a curatorial practice, in which the gestures of selection and presentation are overstylized; a complete collection of data of an institution that starts to unravel at the moment of reduplication; a photographic work whose goal is the medium of the book – an archive that has become a library. If one were to reduce Un-Curating the Archive despite all its ambiguity to a buzzword, the first concept that would come to mind might be the librarchive.
[1] Sheikh, Simon: Towards The Exhibition As Research, in: O‘Neill, Paul; Mick Wilson (ed.): “Curating and Research”, London / Amsterdam: Open Editions / de Appel, 2015, 32–46, here: 40.
[2] Seitz, Hanne: Performative Research, in: Kulturelle Bildung Online, https://www.kubi-online.de/artikel/performative-research (last accessed: 8/15/2018).
[3] Ebeling, Knut: Wilde Archäologien 2. Begriffe der Materialität der Zeit – von Archiv bis Zerstörung, Berlin: Kadmos, 2016, 21.
Translation: Kimi Lum
Un-Curating the Archive
Handapparat, 2017
Ordner für Ordner, Seite für Seite, Dokument für Dokument. In Un-Curating the Archive haben Nicole Six und Paul Petritsch jedes auf den ersten Blick noch so unwichtig erscheinende Detail des Archivs der Camera Austria digitalisiert – und danach ausgedruckt, in der vorgefundenen Reihenfolge zu Büchern gebunden und schließlich den ursprünglichen Ordnungskriterien folgend im Ausstellungsraum präsentiert. Alles. Unzählige Daten, Zahlen, Korrespondenzen, Notizen, Einladungskarten, Ergebnisse von Recherchen, Stücklisten, Ausstellungsideen und Leihverträge aus den Jahren 1974 bis 1989, all dies haben Six/Petritsch kaum bearbeitet. Und doch hat sich vieles verändert durch ihre Intervention in das Archiv eines Hybrids aus Kunstmagazin und Ausstellungsraum, einer Institution, deren Augenmerk im Feld der Fotografie liegt und die sich über ihre Tätigkeit selbst in unzählige Archive und Bibliotheken eingeschrieben hat.
Als „un-curating“ bezeichnen die beiden Kunstschaffenden, was sie mit der Ansammlung von Ordnern, mit diesem mehr oder weniger vorstrukturierten Zettelhaufen, tun und gleichzeitig nicht tun: Material sichten, in Form bringen, bereitstellen und verfügbar machen, auswählen, zeigen. Das Künstlerduo hat für Un-Curating the Archive , für diese Mischform aus Recherche, Intervention und Installation, alles ausgewählt und ebenso alles im Medium der Ausstellung zusammenführt. Wir haben es also hier mit einer besonderen kuratorischen Praxis zu tun. Mit einem Handlungsfeld nämlich, das die Ausstellung nicht nur als Mittel zur Präsentation eines Untersuchungs- oder Forschungsprozesses, sondern als Ort der eigentlichen Recherche begreift, wie es der Kurator Simon Sheikh formuliert: „Das kuratorische Projekt – mit seiner dominanten Form, der Ausstellung – sollte daher nicht nur als eine Form der Forschungsvermittlung verstanden werden, sondern auch als ein Ort der Durchführung der Forschung, als ein Ort der aufgeführten Forschung. Forschung ist nicht nur das, was vor der Realisierung kommt, sondern auch das, was während der Aktualisierung realisiert wird. Was ansonsten als formales Mittel zur Wissensvermittlung gedacht wäre – wie Designstrukturen, Anschauungsmodelle und Wahrnehmungsexperimente – ist hier integraler Bestandteil des kuratorischen Handlungsmodus, seiner Inhaltsproduktion, seiner Vorschläge.“[1] Nicht nur die Reflexion gesellschaftspolitischer Gegebenheiten, nicht nur die Vermittlung von künstlerischen Fragestellungen und fotografischen Themenfeldern wie sie auch von der Camera Austria seit ihrer Gründung bearbeitet werden, stehen bei Un-Curating the Archive im Vordergrund. Sondern das Handeln in einem und das Handeln mit einem Corpus, dessen Potenzial bis dato brachgelegen hat, steckt als Motivation hinter dem Verfügbarmachen des vorgefundenen Materials in seiner Gesamtheit.
Mit jedem Blick in das Archiv der Camera Austria ließe sich aus der Datensammlung eine neue Narration, ein neuer Zeitschriftenartikel, eine neue Ausstellung entwickeln: Geschichten über künstlerische Handlungsfelder und Biografien, Geschichten über den Digitalisierungsprozess der Fotografie seit Mitte der 1970er-Jahre, Geschichten über Verbindungen und Beziehungen zwischen den handelnden Personen – Geschichten, die extrahiert in einer Ausstellung nur unzureichend wiedergegeben können, was eine Institution wie die Camera Austria ausmacht. Einer solchen Entscheidung zwischen Gesamtbild und Detailaufnahme, zwischen Makro- und Mikrofotografie, stellen sich Nicole Six und Paul Petritsch mit Un-Curating the Archive und entziehen sich ihr im selben Moment. Denn sie enthalten den Betrachter_innen ihrer Bücher, den Leser_innen der reproduzierten Archivalia, nicht nur eine subjektive thematische Auswahl oder einen vermeintlich objektiven Überblick über das Material vor, sondern sie gehen einen Schritt darüber hinaus. Indem das Künstlerduo sein Rechercheinstrumentarium, sein Werkzeug, zur Gänze zur Verfügung stellt, haben Betrachter_innen die Möglichkeit, eigene Geschichten aus den reproduzierten Materialien zu schälen, eigene Fragestellungen zu entwickeln, eigene Verbindungslinien abzulesen und nicht zuletzt die eigene Geschichte einer Institution herzustellen. Diesen grundlegenden performativen Aspekt, unter dem künstlerische Handlungsfelder wie jene von Un-Curating the Archive zusammengefasst werden können, beschreibt Hanne Seitz folgendermaßen: „Das Forschungsanliegen will Wirklichkeit weder graphisch einfangen noch sprachlich beschreiben, weder vorgängige Hypothesen überprüfen noch vorausgehenden Fragen folgen, auch keine Prozesse dokumentieren. Es will mit der Praxis identisch sein und im Bearbeiten, Umgehen, Behandeln von Praxis implizites Wissen aktivieren und neue Kenntnis generieren […] – Forschen in eigener Sache, das im Vollzug des Handelns Auskunft gibt und durchaus auch habitualisierten Einschreibungen auf die Spur kommt.“[2] Ordner für Ordner, Seite für Seite, Dokument für Dokument liegt mit Un-Curating the Archive also eine Institution offen vor den Betrachter_innen – ein Potenzial, das nur darauf wartet, entdeckt, benutzt und ausgeschöpft zu werden, ein Möglichkeitsraum also, den das Künstlerduo zum eigentlichen Protagonisten seines Werks gemacht hat.
Nicole Six und Paul Petritsch haben das Archiv im Maßstab 1:1 digitalisiert, gebunden und ausgestellt. Bei dem, was Betrachter_innen mit Un-Curating the Archive als Installation mit Büchern, Tischen, einem Lesedisplay und einer räumlichen Intervention vor sich finden, handelt es sich jedoch nicht mehr um ein Archiv, denn der Arbeitsschritt der simplen aber vollständigen Reproduktion aller Daten hat das Konvolut an Korrespondenzen, Notizen, Einladungskarten, Stücklisten und sonstigen Unterlagen der Camera Austria vom Archiv in eine Bibliothek verwandelt. Denn zieht man eine Trennlinie zwischen Archiv und Bibliothek, so lässt sich der größte Unterschied zwischen diesen beiden Institutionen an ihren Sammlungsgegenständen festmachen: „Die Bibliothek sammelt Werke, das heißt in sich geordnete Artefakte und Datenspeicher, die für ein Gedenken gemacht wurden. Das Archiv hingegen sammelt unprozessierte Objekte, die keineswegs für ein Gedenken gemacht wurden, ‚rohe‘ Daten, ‚unmittelbare‘ Vergangenheit, das Reale.“[3]
Doch während Six/Petritsch die bestehende Ordnung der Materialien des Archivs benutzen, um eine übergeordnete Struktur für ihre Bibliothek zu schaffen, bleibt die materielle Dichte und die Intransparenz des Archivs in Un-Curating the Archive bestehen – eine Setzung, durch welche die Intervention zum künstlerischen Werk wird. In Analogie zur Camera Austria, diesem Hybrid aus Ausstellungsraum und Magazin, ist die Installation schließlich auch als eine Mischform zu begreifen, die sich eindeutiger Zuschreibungen entzieht: Manifestation einer kuratorischen Praxis, in der die Gesten des Auswählens und Zeigens überstilisiert sind; vollständige Datensammlung einer Institution, die sich im reproduktiven Moment der Verdoppelung aufzulösen beginnt; fotografische Arbeit, deren Ziel das Medium des Buchs ist – ein Archiv, das zur Bibliothek geworden ist. Müsste man Un-Curating the Archive trotz aller Mehrdeutigkeit beschlagworten, schnell käme man zum Begriff des Bibliochivs.
[1] Für den vorliegenden Text übersetzt: Sheikh, Simon: Towards The Exhibition As Research, in: O‘Neill, Paul; Mick Wilson (Hg.): „Curating and Research“, London / Amsterdam: Open Editions / de Appel, 2015, 32–46, hier: 40.
[2] Seitz, Hanne: Performative Research, in: Kulturelle Bildung Online, https://www.kubi-online.de/artikel/performative-research (letzter Aufruf: 15.8.2018).
[3] Ebeling, Knut: Wilde Archäologien 2. Begriffe der Materialität der Zeit – von Archiv bis Zerstörung, Berlin: Kadmos, 2016, 21.


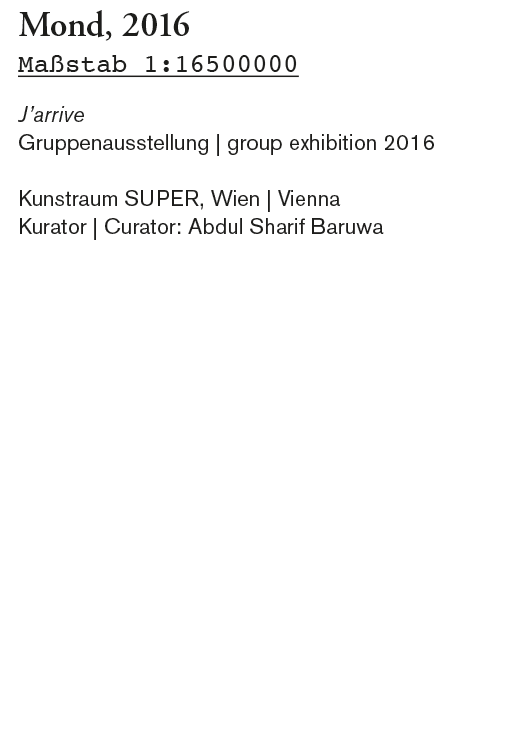
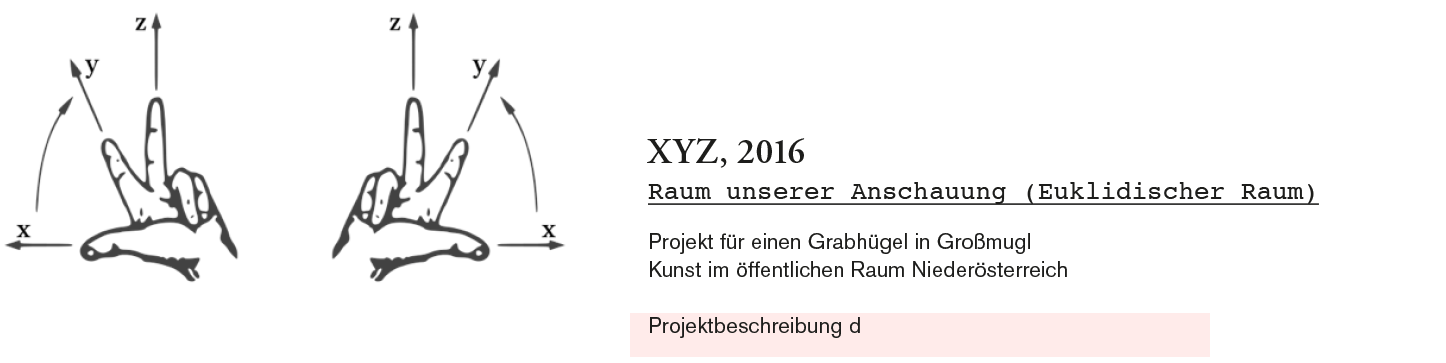
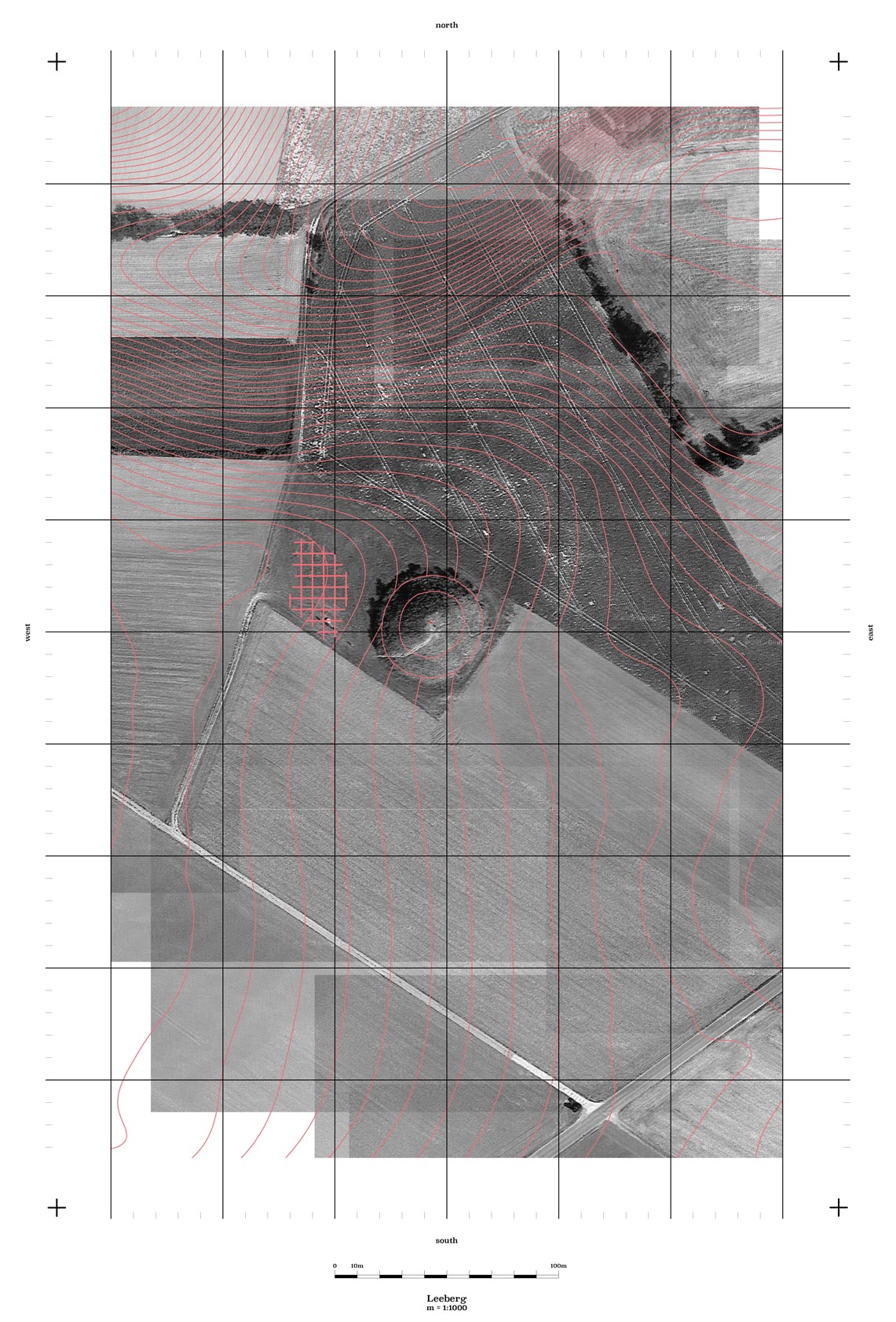
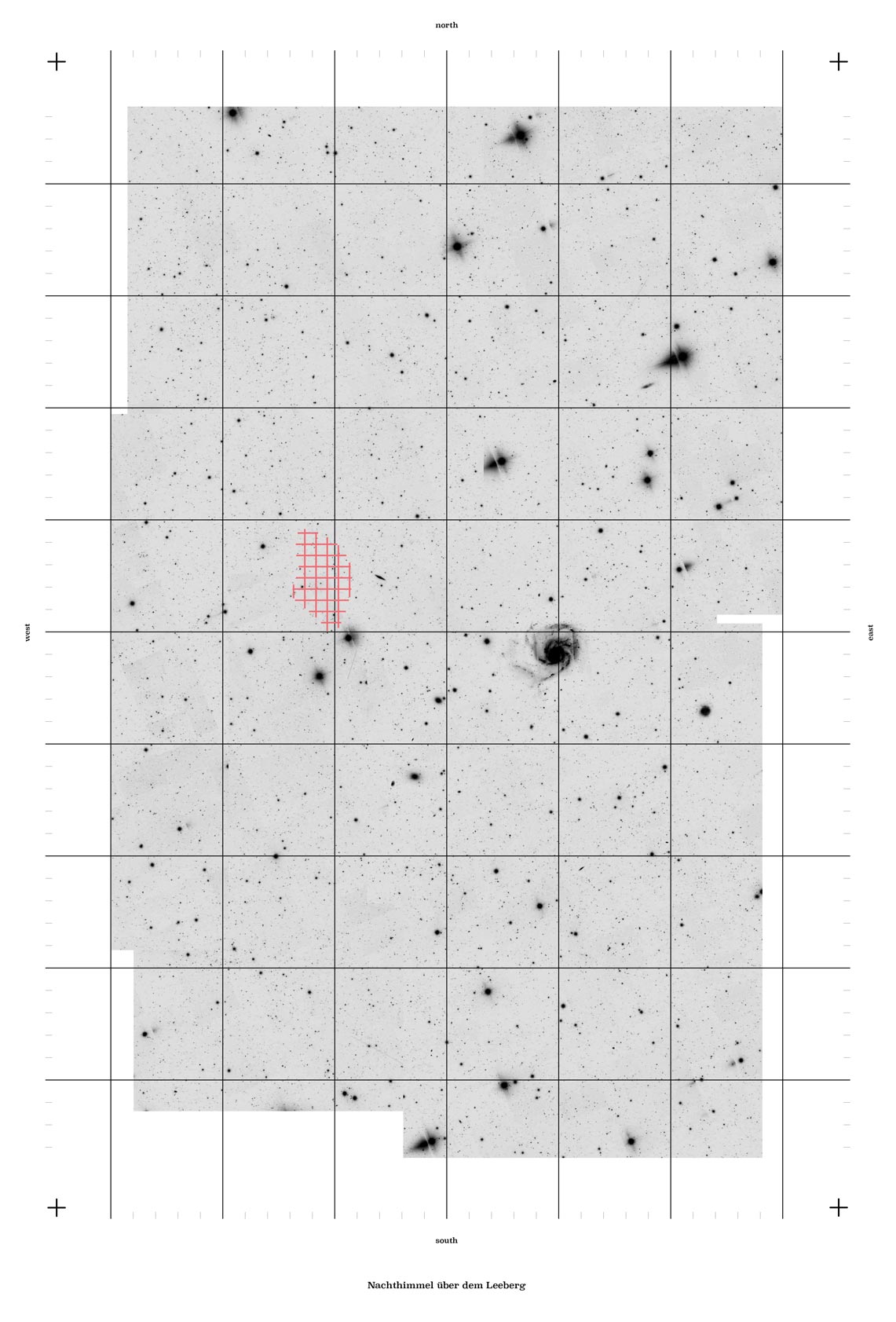
Wege zur Betrachtung und Wahrnehmung
Eine „Wegebene“ wird geschaffen, die den Besuchern ermöglicht einen definierten Standpunkt zum Tumulus einzunehmen und sich dem Hügelgrab gegenüber zu stellen. Es entstehen neue Blickachsen zum Tumulus, zur umliegenden Landschaft und zum Himmel.
Die Ebene erhebt sich aus der Landschaft und wird durch ein Koordinatensystem strukturiert, das nach den Himmelsrichtungen Nord/Ost/Süd/West ausgerichtet ist.
Blick nach Unten - Bodenprospektion
Die 2016 durchgeführte Bodenprospektion enthüllt die vorrömischen Strukturen die sich unter der Erdoberfläche verbergen. Diese Informationen, die sich nicht an der Oberfläche abzeichnen, werden in die Informationsebene des Wegenetzes eingeschrieben und dadurch räumlich nachvollziehbar.
Blick nach Oben - Nachthimmel über dem Leeberg
Als kartographisches Bezugssystem, funktioniert das Netz auch in umgekehrter Richtung:
durch die Ausrichtung nach den Himmelsrichtungen kann auf die Postion von Sternenkonstellationen und die Mondwege Bezug genommen werden. Astronomische Positionen werden direkt mit dem Ort verknüpft.
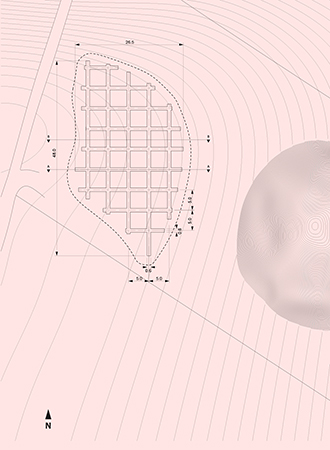
Das Koordinatensystem ist aus Beton ausgeführt, ca. 60cm breite, begehbare Betonstreifen.
Die dem Tumulus zugewandte Kante, der dabei entstehenden Geländeformation verläuft entlang einer bestehenden Höhenschichtenlinie. Es entstehen Wege und Felder, diese werden für den Besucher zu Informationsebenen. Die Ebenen sind thematisch gegliedert und können begangen und frei miteinander kombiniert werden.
- Blick unter die Oberfläche
- Betrachtung eines Hügelgrabes
- Ortsbegehung / Landschaften
- Blick ins All



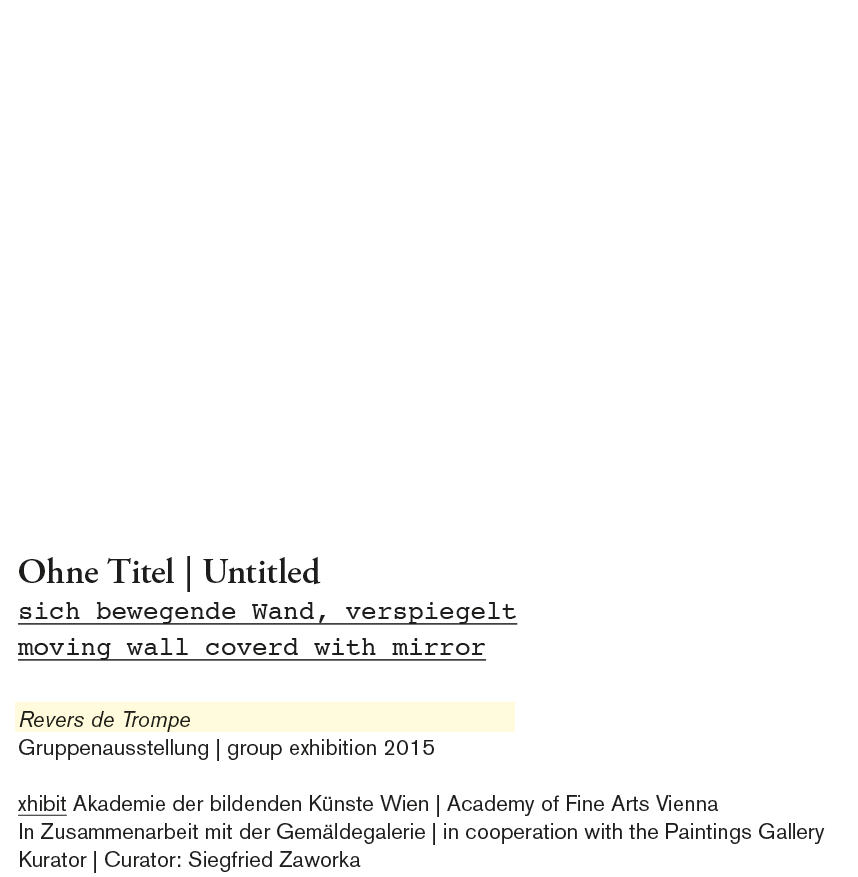

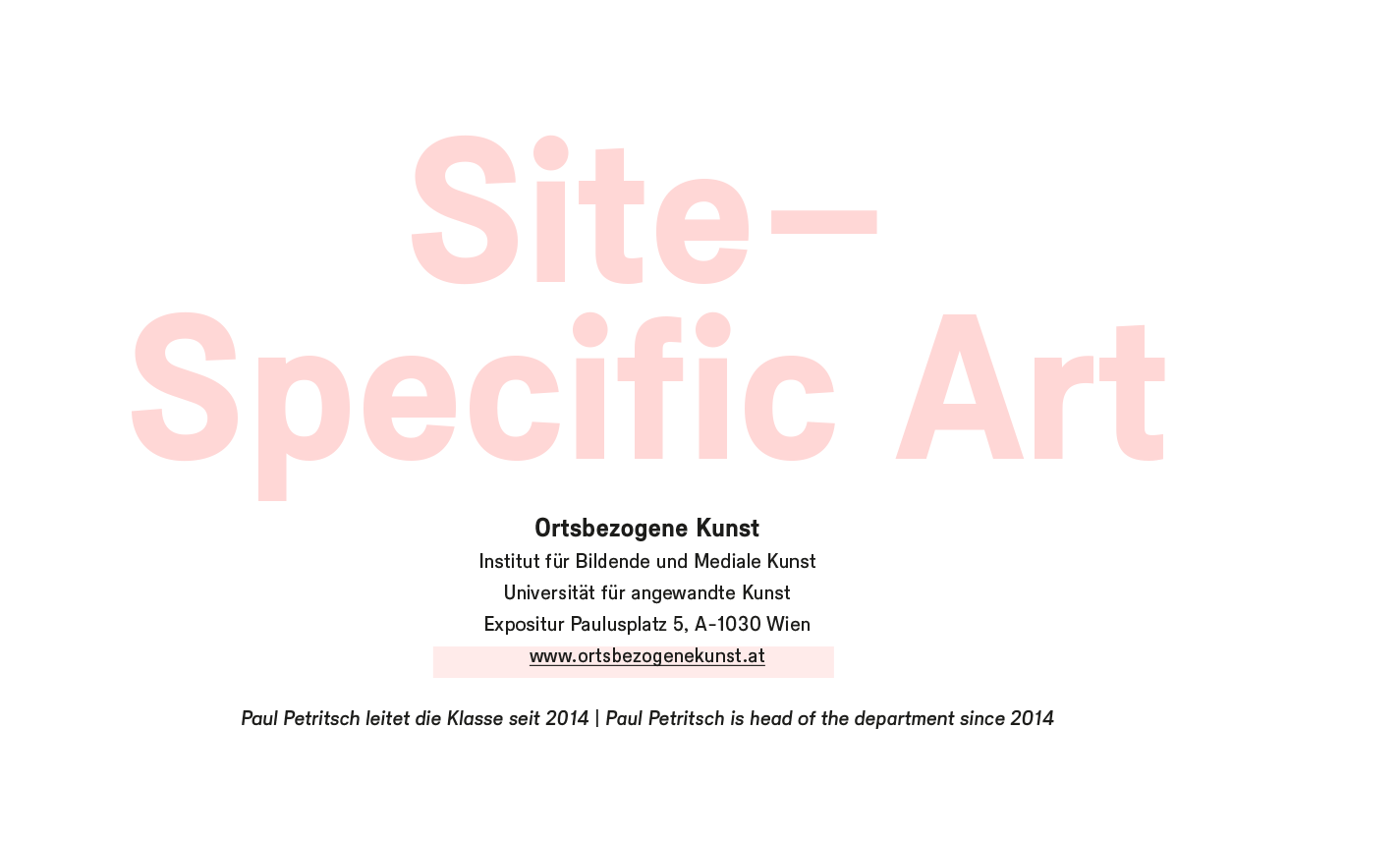


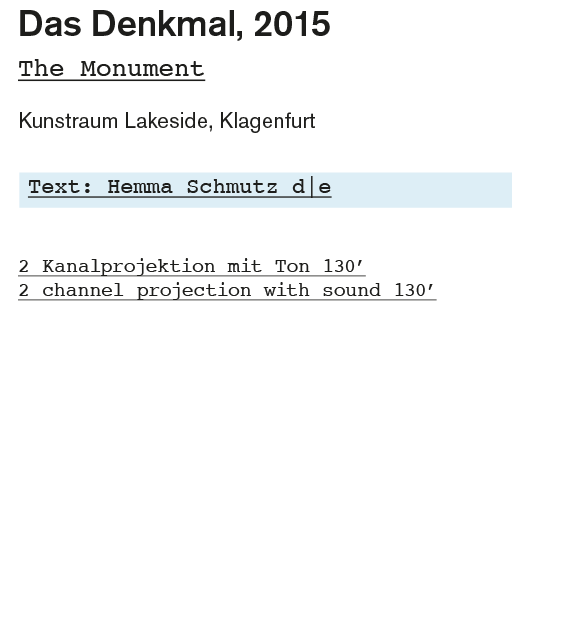


„The Monument“, 2015
In their new project, the artists again raise questions of memory and history. Six and Petritsch are shooting a film about Carinthia. Which symbols or monuments are suitable for expressing the lasting impression of human suffering that comes from war and displacement? How is it possible to escape the perpetuation of political propaganda and the fragmentation of remembrance along the lines of the respective ideological groupings? Sometimes it takes a radical gesture. Art has the freedom to make room for a new memorial culture by overwriting and draining of meaning existing forms of commemoration.
camera and editing: Robert Schabus
cooperation: Peter Petritsch & Andreas Krištof
„Das Denkmal“, 2015
Die Frage, welche Denkmäler wir uns heute erträumen und welcher wir bedürfen, ist auch im österreichweiten und internationalen Kontext virulent. Hier ist die zeitgenössische bildende Kunst gefordert. Es kommt ihr in diesem Zusammenhang eine wichtige Aufgabe zu, die von anderen Institutionen, sei es geschichtliche Forschung oder Politik alleine nicht geleistet werden kann. Diese Aufgabe rührt noch von ihrer ursprünglichen Funktion her, Ort der Gemeinschaft zu markieren und zu gestalten.
„Das Denkmal“, ein Projekt des Künstlerduos Six Petritsch, thematisiert Erinnerungskultur in einem spezifischen lokalen Kontext. „Das Denkmal“ ist sowohl Aktion als auch Ausstellung. Die Künstler nehmen ein Element der Geschichte auf, in dem die komplexe Genese der Erinnerungskultur sichtbar wird. Ziel des Projekts ist, durch erzeugen einer Leerstelle möglicherweise eine Korrektur der bestehenden Praxis des Gedenkens anzuregen.
Kamera und Schnitt: Robert Schabus
Mitarbeit: Peter Petritsch & Andreas Krištof



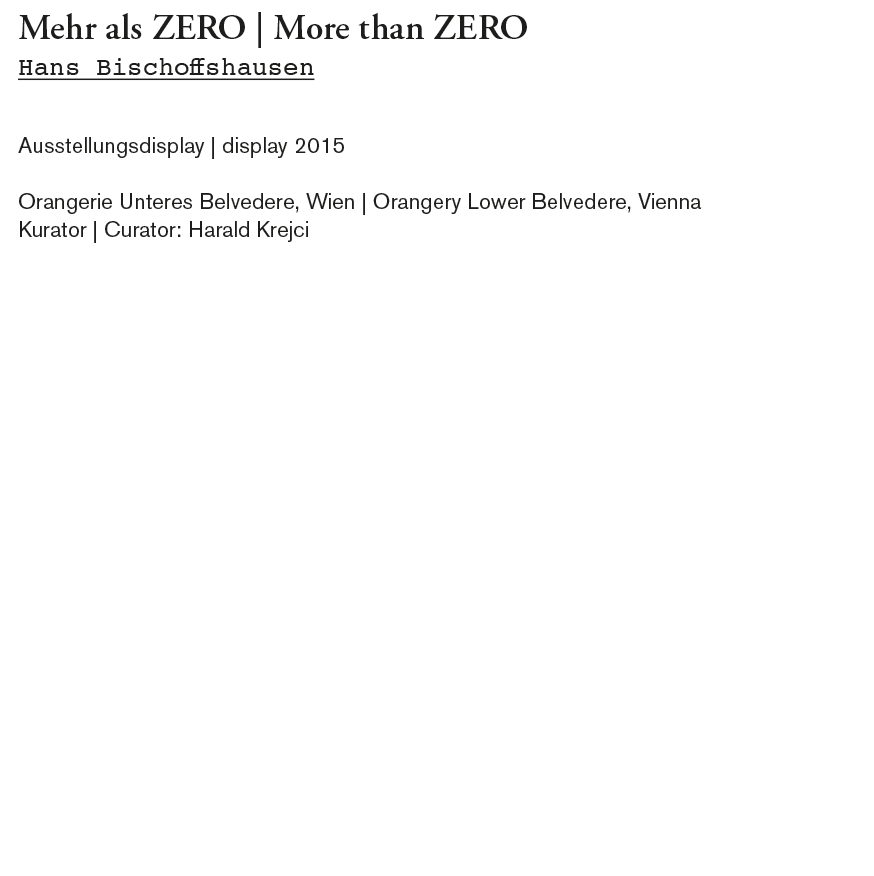



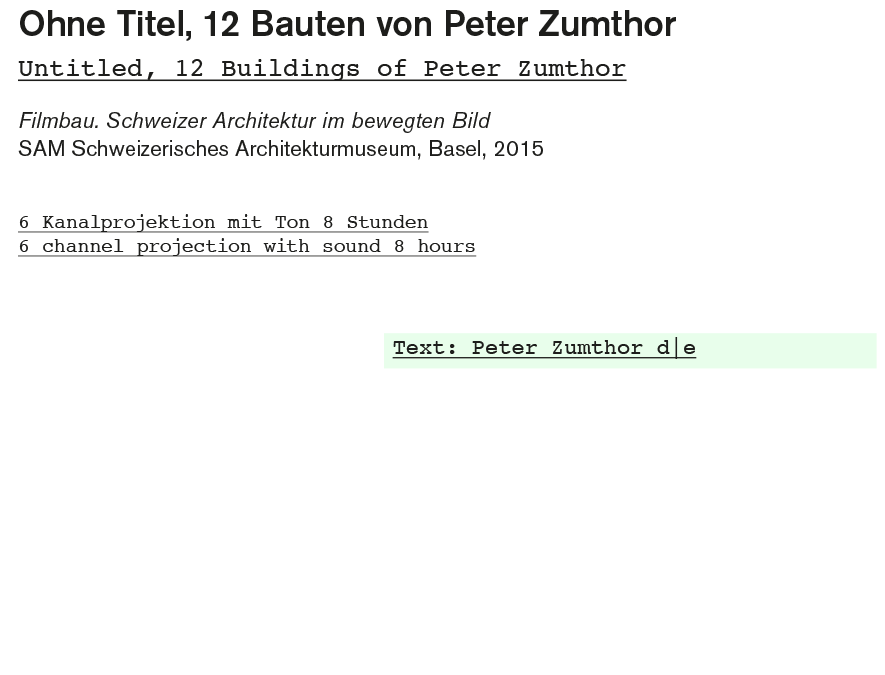

Six screens, six projectors, six cameras
One does not actually see very much of the twelve buildings Nicole Six and Paul Petritsch filmed for the exhibition at the Kunsthaus Bregenz. Six stationary cameras directed simultaneously at six points of a building for forty minutes produce a constant stream of images in which the structure appears from frequently to randomly as part of the surroundings or as the spatial setting for a particular living or recreation situation in the building’s interior. The magic of the images will come from the interaction of these six film sequences as they are simultaneously projected exactly as they were filmed onto six large screens in the exhibition space of the Kunsthaus Bregenz. The screens are freestanding and face in different directions throughout the room. When the film projectors are running, the screens become translucent walls of light that loosely split up the open space of the exhibition level. One wanders from one image to the next, is drawn in to one of them, moves on to the next. As I go from one screen to the next, do I experience this building as a coherent sequence of rooms? No. On the contrary, when I roamed through a trial run of the installation, I was confused for a second. The installation does not offer a readily understandable tour of the building. In this respect, my expectations were vague. But where did this strong feeling of authenticity come from, this sense of a calm undistorted 1:1 representation that immediately overcame me as I wandered about the glowing images of this first screening?
Despite the fact that I was familiar with the concept of the film installation beforehand, I did not realize until later as I was processing my first impressions what the installation really achieves and how it does so: The projectors in the exhibition space have been set up exactly as the cameras had been while shooting the building. The distances from one projector to the next in the museum correspond to the distances between the cameras at the shooting location. The directions from which the films were shot also conform with the alignment of the film projectors, and the films were all shot at eye level and with normal lenses. The playback situation at the Kunsthaus therefore corresponds 1:1 with the shooting situation on location. The viewer in the exhibition space can visit six authentic filming sites and can pace off the exact spatial relations between points. But this is not all: Since one sees all six films simultaneously and experiences them together from different angles in a way that would not be possible in real life, the visual and acoustic impressions start to overlap and consolidate. This creates an atmosphere that for a moment lets me forget the absence of the real object in the Museum.
Perhaps it is true that one often only sees parts and details of the twelve buildings Nicole Six and Paul Petritsch filmed, but one senses them all the more. The installation conveys a feeling of the presence of the buildings in their surroundings and in everyday life, a feeling of the life taking place in and around them. And that is a lot.
Sechs Leinwände, sechs Projektoren, sechs Kameras
Eigentlich sieht man oft nicht sehr viel von den zwölf Gebäuden, die Nicole Six und Paul Petritsch für die Ausstellung im Kunsthaus Bregenz gefilmt haben. Sechs fixe Kameras, die vierzig Minuten lang gleichzeitig auf sechs Stellen eines Hauses gerichtet sind, produzieren laufende Bilder, auf denen das Bauwerk häufig wie beiläufig erscheint, als Teil der Umgebung oder als räumlicher Rahmen einer bestimmten Wohn- oder Aufenthaltssituation im Inneren des Gebäudes. Der Zauber der Bilder entsteht im Zusammenwirken der sechs gefilmten Sequenzen im Ausstellungsraum des Kunsthauses, wo sie gleichzeitig, so wie sie gefilmt wurden, auf sechs großen Leinwänden gezeigt werden. Die Leinwände stehen in wechselnder Ausrichtung frei im Raum. Wenn die Filmprojektionen laufen, werden die Leinwände zu transluzenten Lichtwänden, die den Großraum des Geschosses locker unterteilen. Man schlendert von Bild zu Bild, gerät in den Sog eines Bildes, geht weiter zum nächsten. Erlebe ich nun beim Gang von Leinwand zu Leinwand das dargestellte Gebäude als zusammenhängende Abfolge von Räumen? Nein. Im Gegenteil, als ich die erste Probeinstallation beging, war ich für einen Moment verwirrt. Einen unmittelbar nachvollziehbaren Rundgang durch das Gebäude bietet die Installation nicht an. Meine Erwartungen waren in dieser Hinsicht ungenau. Doch woher rührt dieses starke Gefühl von Authentizität, von ruhiger, unverzerrter Maßstäblichkeit, das mich beim Umhergehen in den zur Probe aufgestellten leuchtenden Bildern sofort gefangen nahm?
Obwohl ich das Konzept der Filminstallation im Voraus kannte, wurde mir erst nachher, beim Verarbeiten meiner ersten Eindrücke klar, was die Installation wirklich leistet und wie sie das tut: Die Projektoren im Ausstellungsraum sind genau so platziert wie die Kameras, als die Aufnahmen im dargestellten Gebäude gemacht wurden. Die Distanzen von Projektor zu Projektor im Museum entsprechen den Distanzen von Kamera zu Kamera vor Ort. Auch die Richtungen, aus denen die Filme aufgenommen wurden, stimmen mit der Ausrichtung der Filmprojektionen überein, und die Aufnahmen sind alle auf Augenhöhe und mit normalen Objektiven gemacht. Die Situation der Wiedergabe im Kunsthaus entspricht somit der Situation der Aufnahmen vor Ort im Maßstab 1:1. So kann man im Museumsraum sechs authentische Filmstandorte besuchen und schreitet dabei ihr genaues räumliches Verhältnis zueinander ab. Aber da geschieht noch mehr: Da man alle Filme im Raum gleichzeitig sieht und beim Durchwandern aus unterschiedlichen Blickwinkeln im Zusammenhang erlebt, wie das in Wirklichkeit nie möglich wäre, beginnen die visuellen und akustischen Eindrücke einander zu überlagern und sich zu verdichten. Damit entsteht eine Atmosphäre, die mich für einen Moment die Absenz des realen Objekts im Museum vergessen lässt.
Ja, vielleicht sieht man von den 12 Gebäuden, die Nicole Six und Paul Petritsch gefilmt haben, oft nur Anschnitte und Ausschnitte. Dafür spürt man sie aber umso mehr. Die Installation vermittelt ein Gefühl für die Präsenz der Bauten in ihrer Umgebung und im Alltag, ein Gefühl für das Leben, das sich
in ihnen und um sie herum abspielt. Und das ist viel.
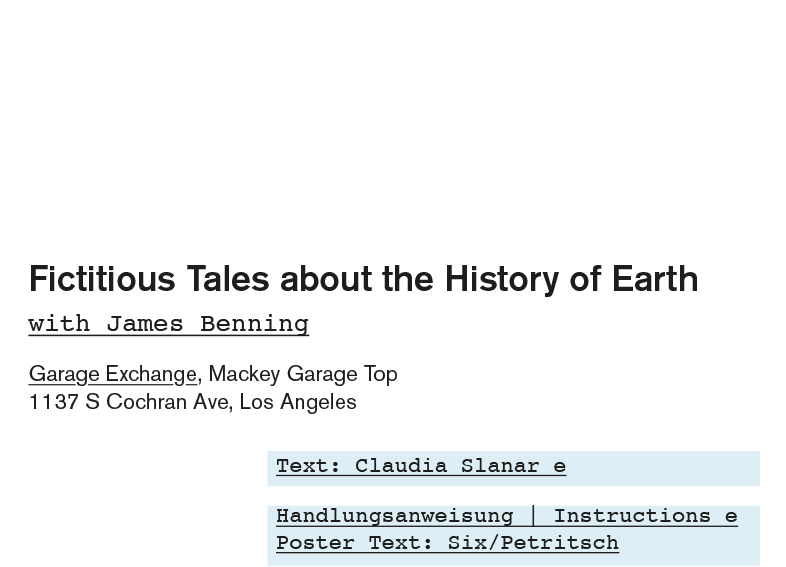
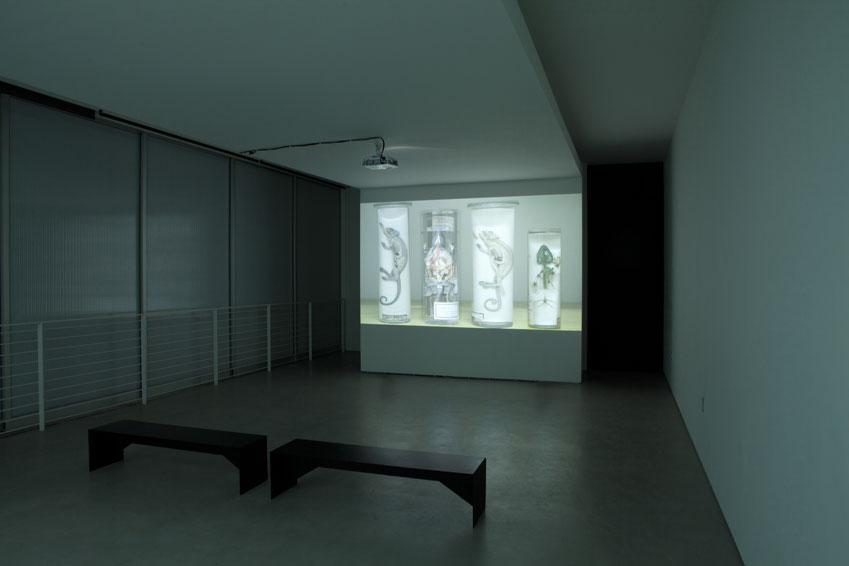
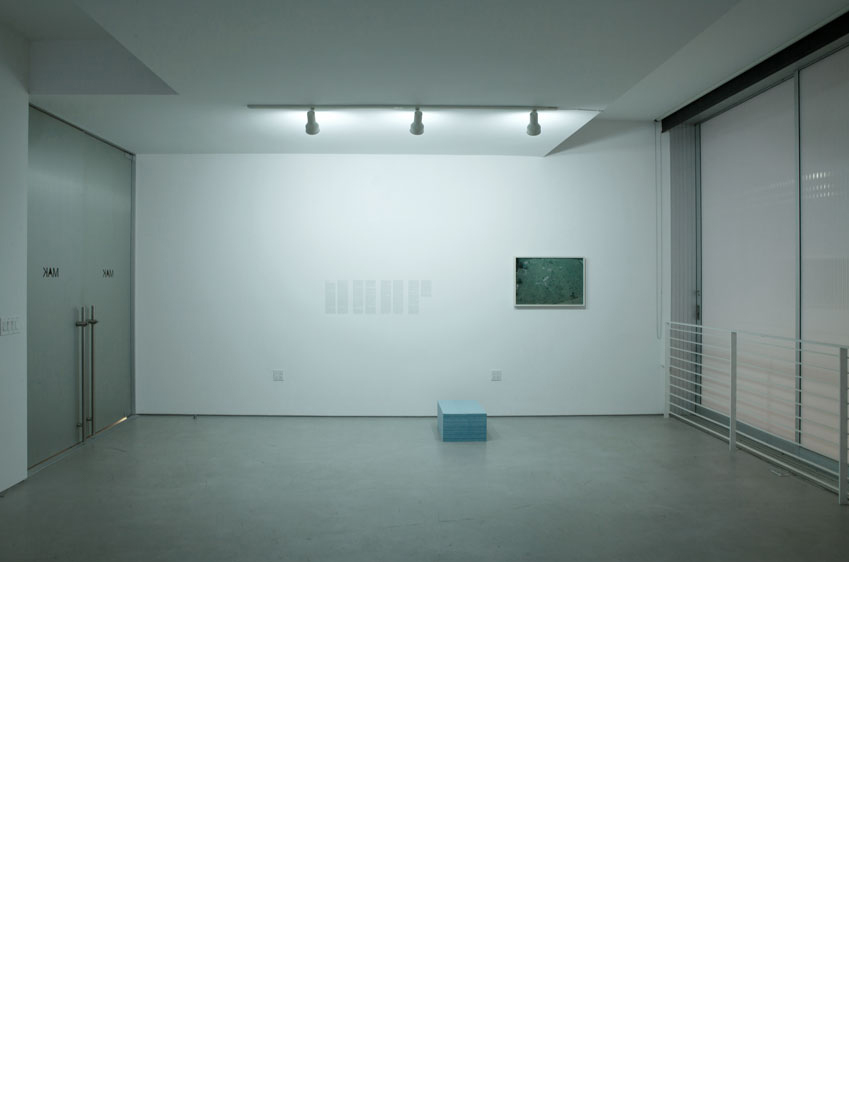
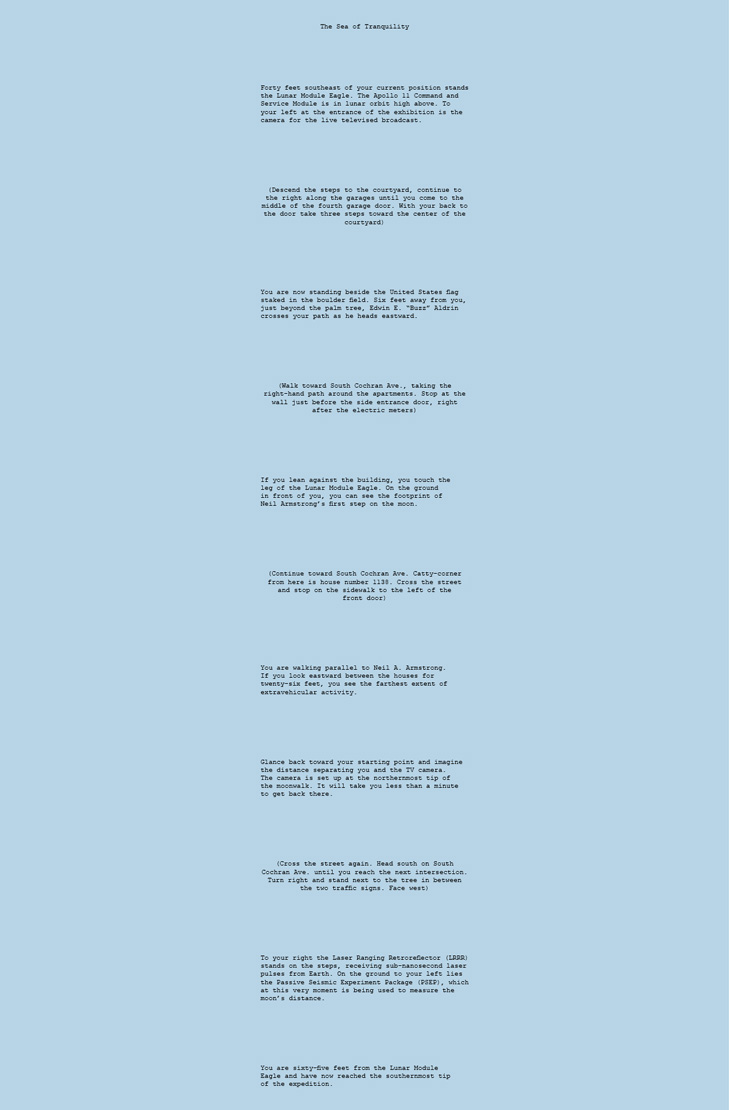
Handlungsanweisung (Instructions)
Nicole Six and Paul Petritsch
Forty feet southeast of your current position stands the Lunar Module Eagle.
The Apollo 11 Command and Service Module is in lunar orbit high above.
To your left at the entrance of the exhibition is the camera for the
live televised broadcast.
garages until you come to the middle of the fourth garage door. With your back
to the door take three steps toward the center of the courtyard)
You are now standing beside the United States flag staked in the boulder field.
Six feet away from you, just beyond the palm tree, Edwin E. “Buzz” Aldrin crosses
your path as he heads eastward.
the apartments. Stop at the wall just before the side entrance door, right after
the electric meters)
If you lean against the building, you touch the leg of the Lunar Module Eagle.
On the ground in front of you, you can see the footprint of Neil Armstrong’s
first step on the moon.
house number 1138. Cross the street and stop on the sidewalk to the left
of the front door)
You are walking parallel to Neil A. Armstrong. If you look eastward between
the houses for twenty-six feet, you see the farthest extent of
extravehicular activity.
Glance back toward your starting point and imagine the distance separating
you and the TV camera. The camera is set up at the northernmost tip
of the moonwalk. It will take you less than a minute to get back there.
you reach the next intersection. Turn right and stand next to the tree in
between the two traffic signs. Face west)
To your right the Laser Ranging Retroreflector (LRRR) stands on the steps,
receiving sub-nanosecond laser pulses from Earth. On the ground to your
left lies the Passive Seismic Experiment Package (PSEP), which at this very
moment is being used to measure the moon’s distance.
You are sixty-five feet from the Lunar Module Eagle and have now reached
the southernmost tip of the expedition.
Fictitious Tales about the History of Earth
Claudia Slanar
“Watch Paleontology in action,” claims the Page Museum, an institution located at the La Brea Tar Pits in Los Angeles. If, as they claim when advertising their expansive collection of fossils, only “the best are on display” what has happened to the others? Where are the fossils that are simply good?
In his most recent film natural history, James Benning directs his concentrated attention toward precisely these objects which are hidden from the regular visitors of a museum. Shot at the Museum of Natural History in Vienna in 2014, the film displays administrative offices, service corridors, cabinets filled with objects, and a storage depot that is located three floors below the palatial galleries of a building which signifies Vienna’s imperial past. Opened in 1889, the museum’s collection dates back to Empress Maria Theresia’s husband Franz Stephan, who was an avid collector of fossils, minerals, shells, and snails. Today it houses
the world’s largest and oldest public collection of meteorites, even including one from Mars.
In his text about the artwork, Benning has put together some of this history in a timeline which is available on the museum’s website. As in some of his earlier films, Benning assembles historic data, combining it with personal, autobiographic information and sometimes even adding fictitious dates thereby appropriating and inscribing himself into history. natural history, 77 minutes of tightly framed shots, follows the mathematic concept of pi, specifically its first 27 digits. When compared to other films of his this creates a less evident rhythmic structure, directing the gaze toward those images that almost only occur as flickers in between the longer shots: a baroque portrait of the royal husband, deerskin sorted according to color and origin, contemporary library cabinets, snakes stored in formaldehyde, a mass of antlers hanging and left to dry in one of the depot’s corridors.
Although a site with naturally occurring phenomena, the La Brea Tar Pits are nevertheless an established brand. On its website, this institution offers an interactive timeline where guests are encouraged to explore prehistoric Los Angeles. Interestingly, this timeline doesn’t attempt to project the earth’s history into the future; it’s as if fossils or found objects in general don’t have a life after being exhibited. On the grounds of the Page Museum fossils are still discovered however, the process then displayed as a real-time spectacle. The excavation site tells a typical L.A. story: ranchers, oil, privatization, tentative public use, and a philanthropist who donates a museum. A black and white aerial photograph featured on the Los Angeles Conservancy’s website shows the site in 1934 when Rancho La Brea consisted of a single ranch on a large plot of land, framed by a gallery of trees and pedestrian walkways lined with parked cars. Cutting through the image from the upper right to the lower left corner, Wilshire Boulevard divides the undeveloped farmland in the north from the already established grid to the south, where houses begin to populate the edges of each plot.
Rendered in color, a separate aerial photograph of farmland shows an open pasture with groups of cows grazing. The grass has been visibly ingested, interspersed with occasional patches of outgrowth. The left side of the image is framed by woods, contrasted by traces of agricultural production at the edges of the pasture. In the center of the image, a meandering path has been cut out of the grass, leaving an almost painterly stain behind. Taken in 2014, this picture is the only documentation of Nicole Six’s and Paul Petritsch’s work The Sea of Tranquility.
With this intervention Six & Petritsch transferred the first human traces in space, left on the moon by the Apollo 11 astronauts in 1969, back to where they originated: earth. Recreated on a plot of remote farmland in Austria to their exact dimensions, the literalness of Neil Armstrong’s “small steps” is evident as they apparently only covered a distance of 50 x 70 meters (approximately 164 ft. x 229 ft. 7 in.). Based on this, is it absurd to speculate about the “carbon footprint” of the first actual footprints on the moon? Are they evidence of a historic event or part of a grand narrative of conspiracy at the end of the 20th century? Forty-five years after the occurrence of the first moonwalk, no other presence has yet disrupted these traces. But it was not these bodily imprints of the astronauts that changed the earth’s relationship to its surroundings, rather the gaze from and to the earth and its manifestation in photographs that have helped to re-invent the earth as a “blue marble” or “blue dot”. Numerous fictions (some as early as Kepler’s Somnium, published in 1609) and phantasms about life on the moon and its possible colonization by humans, have shown the age-old obsession by those stuck living on earth. The sustainability of the traces of human activity left behind on the moon is a signifier pointing precisely to these obsessions. Although being equally immersed in this obsession, Six & Petritsch, as in most of their artworks, explore the disappearance of the traces’ earthly counterparts: in the not so distant future the grass will overtake their marking of the land, the remaining evidence of their performance being only a photograph and its surrounding story.
Situated only two blocks south of the former Rancho La Brea site are the Mackey Apartments. Designed by Viennese-born architect Rudolph Schindler and finished in 1939, they tell a story about various lines of migration which occurred throughout the 20th century. It is here at the installation in the Garage Top where lines of transposition between artists, site, and time overlap, morphing into an experience of duration. When the rather static images of Benning’s film installation are confronted by the performative score of Six & Petritsch’s re-staging of the Apollo 11 moonwalk, the gaze is tied back to the body. And even though the conceptual rigidity of both works is similar, they not only represent but produce different types of gazes. While natural history is clearly that of a filmmaker whose body, although absent from the frame, is felt behind the camera, Six & Petritsch’s aerial shot delegates the human gaze to a more mechanic, machine-like view in which the apparatus is foregrounded. Upon taking the score to perform the footprints in and around the Mackey Apartments, another displacement and timeline has the potential to begin. Its performers, the visitors, are prompted to rethink the relation between site, place and space, the construction of history as well as the possibility of contributing to a future site of excavation.
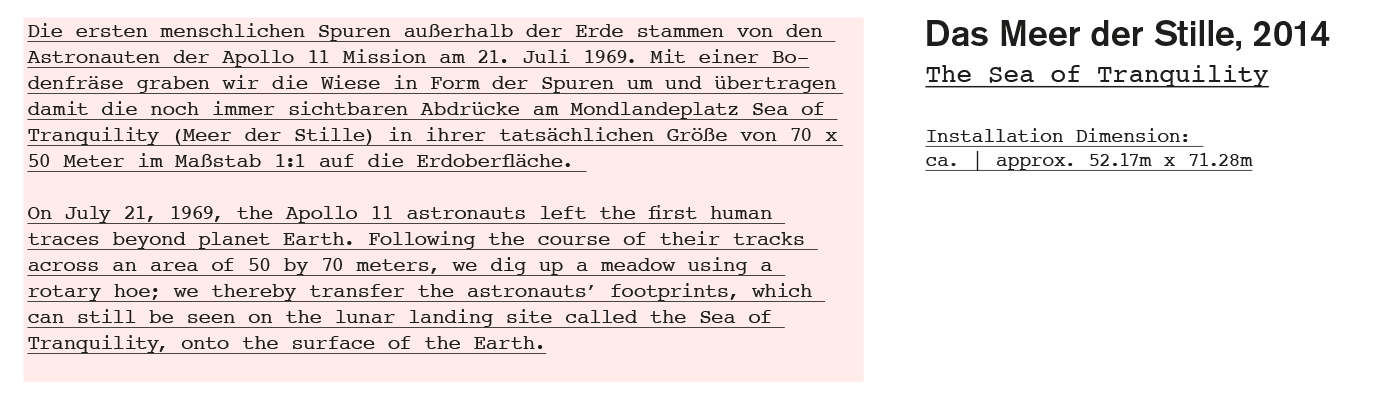

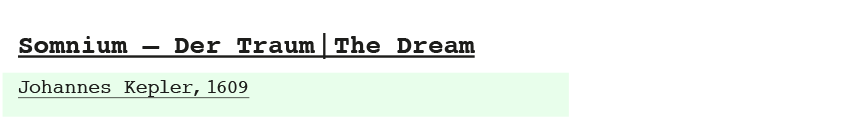
Johannes Kepler
Somnium | The Dream
In the year 1608 there was a vehement dispute between the Emperor Rudolf and the Archduke Matthias, his brother, whose actions reminded, in the opinion of many, old precedents in the history of Bohemia. Excited by the wide interest in the public, I devoted my attention to reading about Bohemia and I came across the story of heroin Libusa, known for her magical abilities. One night, after observing the stars and the Moon, I went to bed and fell into a deep sleep. In it, it seemed that I was reading a book of the Fair, whose content was as follows:
“My name is Duracotus and my country Iceland, called Thule by the ancients. My mother’s name was Fiolxhilde and her recent death has freed me for writing, as I had always desired. While my mother lived she worked diligently to stop me from it. According to her, the arts are filled with phonies who maliciously vitiate what their minds are unable to understand and so build pernicious laws for humanity. There are many who, condemned by these laws, have perished in the abysses of the Hekla2. My mother never mentioned the name of my father, but she told me that he was a fisherman who died at the ripe old age of 150 years (when I was three), and they were on the seventieth year of their marriage.
In the days of my early childhood, my mother used to take me by the hand, and sometimes over her shoulders, to the slopes of Mount Hekla. These trips took place especially around Saint John’s day, when the Sun is visible for 24 hours and there is no night. After picking up some herbs and practicing her rites, she used to cook them at home. Then she filled small bags of goatskin and transported them to a nearby port to sell them to the captains of the ships. Thus she earned her living and mine.
On one occasion, out of pure curiosity, I cut a bag to see its insides. My mother was about to sell it, unsuspecting, when the herbs and some fabrics embroidered with various symbols fell from within. As I had deprived her of our source of income, rather than the bag I myself became the property of the marine and so she kept her money. The next day he sailed by surprise and with favorable wind turned to Bergen in Norway. Within a few days, the North wind rose and the captain directed the boat towards Denmark, sailing between Norway and England, since he should deliver a letter from an Icelandic Bishop to the Dane Tycho Brahe, who lived on the island of Hven. The swaying of the ship and the unusual warmth in the air made me sick, since I was just a fourteen year old lad. When the ship made landfall, the Captain put me and the letter in the hands of a fisherman from the island and, after expressing his desire to return, he set sail again.
As soon as I gave Brahe the letter, he became very happy and started posing me various questions, which I didn’t understand since I did not know their language, with the exception of some words. Accordingly, he instructed his students, who he sustained in large numbers, to mingle with me. Thus, thanks to the generosity of Brahe and a few weeks of practice, I began to speak Danish tolerably well. I was prepared to speak no less than they were to ask, since I wondered about many unusual things and they questioned me about the news that I told them about my country.
Finally, the marine returned to pick me up, but Brahe did not allow him, which made me extremely happy.
At that time I indulged in astronomical exercises in an extraordinary degree. At night Brahe and his students were engaged in the study of the Moon and the stars using wonderful instruments. This practice brought me my mother back, at least in my mind, since she also used to discuss with the Moon. By this stream of events, although I was considered close to a barbarian because of my place of birth and destitute circumstances, I came to the knowledge of the most divine of the sciences, a fact which paved the way for my greatest achievements.
After several years of living on this island of Hveen, I finally desired to return to my native land. Because of the science that I had acquired, I assumed that it would not be difficult for me to get some degree of honor in my own nation of unskilled men. I asked and got permission from my patron to leave, I said goodbye to him and arrived at Copenhagen. My fellow travelers freely took me under their protection due to my familiarity with their language and country. I had returned home, five years later.
The first source of joy was to find that my mother was still alive and carrying on with the same occupations as before. Seeing me alive and important put an end to her continuous greeving for having abandoned her son in a fit of anger. Autumn was approaching, followed by those long nights of ours, since during the month of the birth of Christ the Sun appears just a bit at noon, only to immediately hide again from our view. My mother was always with me now that she was free of work and would not ever leave me, no matter where I went. Due to the letters of recommendation I was bearing, I was questioned on the lands I had visited and even on issues relating to the heavens. My mother took pleasure in comparing the degree of knowledge that I had accumulated with what she herself had discovered as true and said that she could now die, since she was leaving behind a heir to all that science which was everything she had.
I had, by nature, a real thirst to learn new things. So I questioned my mother about her art and which teachers in the country stood out above the rest. Then, on a certain day, when she finally desired to talk, she let me know everything she knew, from the beginning:
“Duracotus, my child, knowledge is available not only in those regions where you traveled to but also in our own homeland. You made me understand the charm of other regions. But even if cold, darkness and other discomforts I now feel that oppress us, in our country there are still many people with talent. Among us there are spirits who reject the greater light of other regions and the noisy chatter of their men and who seek among our shaded areas for chatting intimately with us. Of these spirits, nine were the most outstanding. Particularly one of these, of the most gentle and innocent kind, was known to me. This spirit was evoked by 21 characters. Often, in a fraction of a second, I was sent by his power to other shores that I selected. If I was kept away from certain places due to the distance, I made up for this by questioning him about those places as if we were there. Many of the things you saw with your own eyes or hear say or absorbed from your books, he told them to me as you yourself have done. I wish to take you, in particular, to visit a region about which he has spoken to meso often, one filled with very notable things”. The name my mother mentioned was “Levania”.
I hastily agreed that she should summon her great teacher. I sat down, ready to listen to both the travel plan and the description of the region. Spring had already reached our region. The Crescent began to shine as soon as the Sun hid under the horizon, joining the planet Saturn in the sign of Taurus. My mother went away from me to the nearest crossroad and screamed, uttering a few words and setting her request. Later, she completed the ceremony, returned and demanded silence with the palm of her right hand extended, and sat close to me. Hardly had we tucked our heads under a cloth (as it was customary) when a raspy and unrecognizable voice arose, which immediately began to speak in this way in the Icelandic language.
The demon of Levania
“50,000 German miles up in the ether lies the island of Levania. The passage to this island from our land, and vice versa, is rarely open, but when it is accessible, it is easy for our kind. However, the transport of men is difficult and dangerous for their lifes. We do not accept men who are sedentary, corpulent or whimsical in our expeditions. Rather, we prefer those who dedicate their time to ride a fast horse with persistence or those who frequently sail to the Indies, who are accustomed to survive two times a day only by means of bread, garlic, dried fish and other unpleasant dishes. There are lean elderly women who are particularly suited for our purpose. The reason for this is well known: from early childhood they are used to ride male goats, tridents, and to travel through the vast extension of the land. Although Germans are not suitable, we do not reject the firm bodies of the Spaniards.
The tour, though it may be far away, is completed in only four hours. We are always very busy and agree not to leave until the Moon starts its eclipse in its easternmost sector. If the Moon becomes full while we’re still on track, our journey back becomes impossible. Since the time is so short, we only take a few humans and only those who are most devoted to us. We choose a few of these men, and after forming a group with them, we push them up toward the heights. The initial shock is the worst part for them, since they are launched upward as if by a gunpowder explosion and they fly over mountains and seas. Therefore, they must be drugged with narcotics and opioids before the flight. In addition, their limbs must be carefully protected so that the trunk is not separated from the buttocks, or the head from the body, thus ensuring that the recoil expands equally through each limb. Then new challenges arise: the intense cold and the deterioration of the breathing. The cold is relieved thanks to a natural power in us; breathing is by placing soaked sponges in their nostrils. Once the first section of the crossing has been completed, our trip becomes easier. We expose them freely to the air and remove our hands. All of them wrapped around themselves, as spiders, form balls that we almost entirely guide by our own will, so that their masses move freely towards their place of arrival. But this movement is of little use to us, since it is too late. This is why we speed up by gravity and go ahead of the bodies of men, lest by a very strong impact on the Moon they could suffer some damage. When the humans awake, they usually complain that all of their limbs suffer an ineffable lassitude, which, however, goes away completely when the effect of the drugs disappears and they can thus return to walking.
Many other difficulties arise during the trip, which would take too long to list. On the other hand, nothing bad happens to us. Since as a group we live in the shadows of the Earth, no matter how long they be, when these men arrive at Levania, here we are, as if we disembarked from a ship to Earth. After that, we retire quickly to caves and shady places so that the Sun does not expire while we are on open spaces and obliges us to follow the shadows on its withdrawal. That grants us time for our leisure and to follow our inclinations. We consulted the demons of the province, and formed a League. Whenever there is a space with shade, we unite our ranks and go there. And if shadow strikes Earth with its sharp tip, which often happens, we drag our feet on that land along with our colleagues. This is permitted to us only when men are witnesses of a solar eclipse. This shows that eclipses of the Sun are to be feared.
I have already said enough about the trip to Levania. I will now speak about the form of the Province itself, beginning, as geographers usually do, with their vision of the sky.
The fixed stars look the same in Levania as on Earth. But the movements and sizes of the planets are very different from those we see from it, so all their astronomy is diverse.
Much like geographers divide the globe into five zones, according to the celestial phenomena, Levania is divided into two hemispheres. One of them, the Subvolvian, always enjoys their Volva, which for them is like our Moon. Another, the Privolvian, is completely deprived from any view of the Volva. The circle that divides both hemispheres, comparable to the colure of the solstices, passes through the celestial Poles and is called the Splitter.
I will first explain what is common to both hemispheres.
All Levania is subject to the same succession of day and night, like the Earth, but it lacks other changes during the year. Throughout Levania days are almost equal to nights, except for the fact that for the Privolvian hemisphere day is shorter than night, while in the Subvolvian day is longer. What is altered in an eight-year cycle will be mentioned later. In order to produce the same nights at both Poles, the Sun is hidden during half of the time, while during the other half it shines, on its trip in a circle around the mountains. Levania appears still to its inhabitants, no less than our land seems to us. One of our months equals one of their nights and one day. When the Sun is going to rise, early in the morning, a new zodiac sign appears. For us, the Sun turns 365 times in a year and the orbits of the fixed stars 336 times; or more precisely, in four years the Sun turns 1461 times and the orbits of the fixed stars 1465. For them, in a year the Sun rotates around them 12 times and the sphere of the fixed stars 13; or more precisely, in 8 years the Sun completes 99 laps and the fixed stars 107 orbits. But they are more familiar with a cycle of 19 years, for in this amount of years, the Sun rises 235 times and the fixed stars 254 times.
The Sun rises in the inner and central parts of the Subvolva when the last quarter of the Moon is visible for us; then, in the middle parts of the Privolva when the first quarter is visible for us. What I say about the middle parts must be understood by applying semicircles through the Poles, with the Center at right angles with the Splitter. We can call them the Medivolvian semicircles.
The intermediate circle between the Poles, which produces the same effect as the Equator of the Earth, will be called by the same name. It cuts the Splitter in equal parts and the Medivolva at opposite points. The Sun passes above some places in the Equator in two opposite days of the year, precisely at noon. For all those who live on both sides of the Equator, the Sun deviates from the zenith at noon.
On Levania there is some variation between summer and winter, but one should not compare them with the Earth´s, nor do they always occur in the same place at the same time. Over a period of ten years their summer changes from one part of the sideral year to the opposite side. The reason is that in a cycle of 19 stellar years and 235 days, summer and winter occur 20 times near the Poles and 40 at the Equator. Each year has 6 summer days and 6 winter days, as our months. This alternation is barely felt around the Equator because the Sun does not deviate to the sides more than 5 degrees. On the other hand, it is much more felt at the Poles and in those places that enjoy or miss the Sun alternately at intervals of six months, as some places do on Earth. The globe of Levania is also divided into five areas corresponding, to some extent, to our Earth´s areas, with the exception that the torrid and frigid zones encompass just 10 degrees each. The remainder is equivalent to our temperate zone. The tropical zone goes through the center of each hemisphere, half of its length through the Subvolva and the other half through the Privolva.
The intersection of Equatorial and zodiacal circles creates four corners, as our equinoxes and solstices. These sections give birth to the zodiacal circle. But, from the beginning, the movement of the fixed stars is very fast, twenty tropical years (defined as a summer and a winter). For us, the fixed stars go through the full Zodiac every 26,000 years. So far, this is what concerns the first movement.
The theory of secondary movements is no less diferent for them than it is for us, while it is much more intricate. The reason is that in addition to the many irregularities shown by the six planets (Jupiter, Mars, Saturn, the Sun, Venus and Mercury), they witness three more. Two of them are in length; one daily, the second in a period of 8 and 1/2 years, the third of latitude in a 19 year cycle. For the middle Privolvians see the Sun larger at noon than when it rises, while the Subvolvians see it smaller than upon rising. Both believe that the Sun inclines towards the Subvolva for a few minutes, back and forth from the ecliptic and then among the fixed stars. These oscillations, as I have already said, go back to the starting point in a period of 19 years. Even so, this variation takes more time in the Privolva and somewhat less in the Subvolva. And although it is assumed that the Sun and the fixed stars advance evenly around Levania in its first movement, the Sun hardly moves in relation to the stars for the Privolva at noon while it appears very fast for the Subvolva, while the opposite is true for midnight. As a result, the Sun seems to give daily jumps among the stars.
The same is true in the case of Venus, Mercury and Mars; these phenomena are almost imperceptible for Jupiter and Saturn.
In addition, the daily movement is not uniform every day at similar hours. On the contrary, it is sometimes slower not only for the Sun but also for the fixed stars and it becomes faster in the opposite part of the year at the same time. Moreover, this delay changes during the year, in such a manner that it now takes place on a summer’s day and then on a winter´s, completing the cycle in a period of less than nine years. Hence, the day becomes sometimes longer than the night (because of a natural slowness, not - as it is the case on Earth - by an uneven section of the orbit on a calendar day) and sometimes the night becomes longer.
But if the delay lies above the Privolva during the night, its excess on the day is increased; If, on the other hand, it happens during the day, then night and day are more evenly matched, something that only happens completely once every 9 years. And the opposite is true for the Subvolva.
So far for the common characteristics to both hemispheres.
The Privolvian hemisphere
With regard to each hemisphere separately there is a great contrast between them. By its presence or absence, the Volva gives rise to very dissimilar spectacles. And not only that, but rather common phenomena differ greatly here and there in their effects. As a result, one could perhaps more correctly call the Privolvian hemisphere intemperate and the Subvolvian temperate. The night of the Privolvians lasts for 15 or 16 of our days, terrible for its endless shadows, just like our nights with no Moon. Not even the rays of the Volva cast their light upon them. For this reason everything becomes rigid ice, spray and is subject to the most powerful and fearsome winds. Then follows the day, long as 14 of our days, or a little less. During this time the Sun appears quite large and moves slowly with respect to the fixed stars. There are no winds. As a result, the heat becomes unbearable. Thus, for the space of one of our months or a day of Levania, one same place is exposed to a heat 15 times higher than that of Africa and a cold more unbearable than that of the Quivira.
It should especially be noted that the planet Mars is sometimes seen as almost twice as large of what we see it; this happens for those who live in the central parts of the Privolva at midnight and for the rest at the beginning of their own night.
The Subvolvian hemisphere
As we move onto this hemisphere, I will start with their frontiermen, those who inhabit the dividing circle. Particular to them is the fact that the observed digressions of Venus and Mercury with respect to the Sun seem to them much greater than to us. Venus appears to them at certain times as double or greater than our vision of it, especially to those who live near the North Pole.
But the most pleasant of all the visions in Levania is the contemplation of the Volva. They enjoy the view of the Volva instead of our Moon, of which both the Privolvians and themselves completely lack. Due to the perennial presence of the Volva, this region is called Subvolva, as the other one is called Privolva because it has been deprived of its view of the same.
When our Moon rises full and travels over houses and distant mountains, the inhabitants of the Earth see it as the circle of a large wooden barrel. When it rises to the middle of the sky, it brings to mind something resembling the shape of a human face. But for the Subvolvians their Volva, when it occupies the middle of the sky (the Volva takes this position for those who live in the center of this hemisphere) acquires a diameter slightly less than four times more that of our Moon, so if we make a comparison between these discs, the surface of the Volva is fifteen times greater than our Moon. For those for whom the Volva continually rubs the horizon, it appears in the form of a distant burning mountain.
Just as we tell apart our regions by means of their higher or lower elevations in relation to the Pole, although we do not necessarily see the Pole with our own eyes, so the altitude of this ever-present Volva meets the same need for them, since it is always visible and varies in altitude in different places.
While, as I said, the Volva hangs directly over the head of certain of them, everywhere else it seems to have been sucked down, close to the circle of the horizon, and for the remaining regions its altitude differs between the zenith and horizon and always remains constant.
Even so, the Subvolvians have their own Poles that are not among the fixed stars, where we have the Poles in our world, but around other fixed stars which to us point to the Poles of the ecliptics. In 19 lunar years these Poles cross small circles around the Poles of the ecliptic in the constellation of Draco and their opposites, Xiphias [Golden] and Paser [Piscis Austrinus] and the Great Nebula. Since these Poles are approximately to a quadrant of the Volva, their regions can be classified according to the Poles and in relation to the Volva, resulting in an obvious advantage for them over us in this respect. For they indicate places in relation to their stationary Volva and latitude both by their Volva and the Poles. This is different for us because there is no way to get our lengths except by the servile tilting of a hardly distinguishable magnetic needle.
The Volva of the Subvolvians remains stationary as if united with a nail to the heavens. Above it, other celestial bodies and the Sun itself cross from East to West. There is no night in which none of the fixed stars in the Zodiac will not hide behind this Volva and once again emerge in the opposite region. Although not the same fixed stars do it every night, all those stars who are at a distance of 6 or 7 degrees from the ecliptic also take turns in this task. In 19 years, the entire circuit is completed and each one of them is brought back to its original position.
The Volva also doesn´t increase more or less than our Moon. The same cause exists for both cases: the presence of the Sun or its departure. Its duration is also the same according to nature, but the Subvolvians and we measure it by different methods. The Subvolvians consider that a day and a night is the span of time during which all increases and decreases of the Volva are completed. We call this space of time a month. The Volva is rarely hidden from the Subvolvians even in new Volva because of its size and brightness, and even more so in the case of the polar inhabitants lacking the Sun at that time. For them, the Volva rotates its horns upwards at noon, in the Intervolvian period. In general, for those who live between the Volva and the Poles below the Medivolvian circle, the new Volva is the signal of noon, the first quarter of night, the full Volva of midnight and the last quarter brings the Sun back. Those who observe the Volva and the Poles located on the horizon live at the intersection of the Equator with the Splitter, and their morning and evening come with full Volva and their noon or midnight with the quarters. From these observations we can draw conclusions about those who live among these places described above.
The Subvolvians distinguish the hours of the day by means of these and other phases of the Volva so, for example, the closer they are to the Sun and the Volva, the nearest noon is for the Medivolvians and night or Sunset for those who live close to the Equator. The Subvolvians are much better equipped than we are to measure periods of night, which regularly lasts 14 hours, since in addition to that sequence of phases of the Volva, whose full Volva marks the middle of the night for the Medivolva, the Volva itself serves them to distinguish the hours. Although the Volva seems in no way to change of place, contrary to our Moon it rotates and shows a surprising amount of marks and points that are constantly changing from East to West. When one of these marks returns after one of these revolutions, the Subvolvians consider that they spent an hour, equivalent to a little more than one of our days and nights. This is the only uniform measure of time since, as we have indicated previously, the Sun and the stars rotate daily around these lunar inhabitants in an irregular manner. This lack of uniformity is clearly revealed by the rotation of the Volva when compared with the distances of the stars to the Moon.
The upper section of the North Volva seems to have two halves; that is, one that is rather hidden, as if it were covered with continuous marks and the other somewhat more clear, interpenetrated by a bright belt up North that serves as a dividing line of the two. The dark half is hard to explain, however in its easternmost section we perceive something as the front of a human head cut off by the shoulders, bending to kiss a girl dressed in a long robe while the arm is extended backwards to try to capture a jumping cat. The wider and larger part is projected to the West without a recognizable form. In the other half of the Volva, brightness extends more widely than the mark itself. It could be described as the image of a bell hanging from a rope and swaying towards the West. The upper and lower parts cannot be compared to anything.
Besides distinguishing the hours of the day of the Subvolvians in this way, the Volva gives them clear indications of the seasons of the year if proper attention is paid, or if recognition of the fixed stars is unknown to the observer. Even when the Sun passes through Cancer, the Volva clearly indicates the North Pole of its rotation. There is a small dark spot above the image of the girl, above the bright area. From the highest and most remote part of the Volva this point will move to the East; and from there, as it descends on the disc, it moves westward. The marks withdraw once again from the last position towards the East, towards the top of the Volva and thus always remain visible. But when the Sun enters Capricorn, this place cannot be seen since the entire circle with its Pole is hidden behind the body of the Volva. During these two periods of the year the points move linearly to the West. During intermediate periods of Aries or Libra these points sink across or climb in a crooked line. This fact shows us that while the center of the Volva remains at rest, the Poles of this rotation evolve in an Arctic circle around the Poles of the Lunar inhabitants once a year.
The most diligent observers are also aware that the Volva is not always the same size. During the hours of the day in which the heavenly bodies move quickly, the diameter of the Volva is much bigger, clearly four times larger than our Moon.
What can I say now about the eclipses of the Sun and the Volva? Levania´s eclipses occur at the same time that eclipses of the Sun and the Moon are seen here on Earth, but obviously for opposite reasons. When we see a total eclipse of the Sun, their Volva is overshadowed and in the same time, when our Moon is eclipsed, the Sun is eclipsed for them. Even so, this correspondence is not absolute. They often see partial Sun eclipses when a part of the Moon is hidden to us. And on the contrary, they are often exempt from eclipses of the Volva when we have partial eclipses of the Sun. They have eclipses of the Volva in full Volva as well as we have our Moon eclipses in full Moon; they have new Volva eclipses of Sun as we have ours in new Moon. Since they have long days and nights, they experience more frequent eclipses of both celestial bodies. And as well as a large number of our eclipses occur in our antipodes, their antipodes, since they are Privolvians, are not witness to any of them, while the Subvolvians see them all.
The Subvolvians never see a total eclipse of the Volva, but a small point, reddish-brown in its outline and dark in the center, crosses over them through the body of the Volva. This small spot makes its entrance in the eastern section of the Volva and disappears through the western edge, just as the natural points of the Volva, but surpassing them in haste. Its duration is extended to one-sixth of their hours or four of ours.
The cause of their solar eclipses is the Volva, as our Moon is the cause of ours. This phenomenon is inevitable, taking into account that the Volva measures four times more than the Sun. While the Sun crosses from East through the South beyond the Volva, on its journey to the West, it often remains hidden behind the body of the Volva. Although such disappearance is frequent, it is equally remarkable that it lasts several hours and both the Sun and the Volva are among the shadows at the same time. This is a great spectacle for the Subvolvians, whose usual nights are not much darker than their days, due to the brightness and magnitude of their omnipresent Volva, while during the eclipse of the Sun both celestial bodies, the Sun and the Volva, remain hidden.
Even so, their eclipses of the Sun have the following peculiar feature. It frequently occurs that as soon as the Volva is hidden behind the Sun, a brightness rises on the opposite side, as if the Sun had expanded and embraced the whole body of the Volva when, at other times, the Sun seems much less voluminous than she. Therefore, complete darkness does not always ensue, until the centers of the bodies coincide closely and the condition of the half-transparent medium is adequate. Nor, on the other hand, does the Volva disappear suddenly so that it can not be discerned at all, although the Sun sets completely behind it; the only exception occurs at the intermediate time of a total eclipse. At the beginning of such an eclipse, however, the Volva continues to be white in some sections of the Splitter, as if it were a coal once the flame has been extinguished. After this whiteness disappears, the midpoint of the total eclipse has been reached (since it only disappears completely during this type of eclipse). When the whiteness of the Volva returns (in opposite places of the Splitter of the circle), the Sun is closer to be seen. Thus, both bodies disappear in the middle of the total eclipse.
So far the phenomena that happen in the two hemispheres of Levania: the Subvolvian and the Privolvian. From these considerations it is not difficult to give an opinion, without my saying anything, on how the Subvolvians and the Privolvians differ in many respects.
A Subvolvian night, even if it lasts 14 of our nights, lights up the surface and protects it from the cold by the presence of the Volva. A large mass like that, with so much glitter, cannot but keep the surface hot.
And on the other hand, although the Subvolvian has the annoying presence of the Sun along 15 or 16 of our days and nights, their Sun is smaller and does not have as much strength. The united luminaries attract all the water to this hemisphere until the surface has been completely covered, so very little of it stands out. On the contrary, when the water has been removed from the Privolvian hemisphere, it becomes dry and cold. However, when the night begins for the Subvolvians and the day for the Privolvians, the celestial bodies are divided between both hemispheres, and thus water is divided; the Subvolvian fields dry up while water brings some rest from the heat for the Privolvians.
The whole of Levania extends no more than 1,400 German miles in circumference, a quarter of our Earth. It has very high mountains, very deep and wide valleys and consequently it is not comparable to our Earth for its perfect roundness. The entire surface is porous, as if bored through hollow caverns and caves, especially frequent throughout the Privolvian hemisphere. These hollow places are the main way for Privolvians to protect themselves against the heat and cold.
Everything that springs from their land or treads on it is of a monstrous size. Increases in size are very fast. Life is short because all living things are huge body masses. The Privolvians have no fixed dwelling or home. In the space of a single day, they go across all of their world in hordes, following their receding waters using their legs, which are longer than a camel´s, or by means of wings or boats. Should a delay of several days be necessary, they creep through the caves depending on the nature of each of them. Most of them are divers and they all breathe very slowly. They can take refuge in the bottom of the deep waters, combining nature with art. It is said that those who are in the depths of the water stand the cold, while the surface waves are steaming by the action of the Sun. Those that remain on the surface are boiled by the midday Sun and serve as food for the hordes of errant settlers. In general, the Subvolvian hemisphere can be compared to our cantons, towns and gardens while the Privolvian is similar to our fields, forests and deserts. Those for whom breathing is essential take refuge in caves whose water supply is guaranteed by narrow chanels that allow water to be cooled gradually during its long-distance voyage, and they use it for drinking; but when night comes, they go out for food. The bark of the trees, the skin of living beings, or anything else which takes its place, occupy most of their corporeal mass and it is porous and spongy. If any being is surprised by the heat of day, its skin becomes hard and scorched and falls during the night. Everything that springs out from the soil, on the mountain tops, grows and dies on the same day, making daily space for it to be replaced by new beings.
In general, a serpentine nature is predominant. In a wonderful way they expose themselves to the Sun at noon, but always near the mouths of their caves, so that they can retreat quickly and safely.
For some, the courage they have exhausted and the life that they have lost by the heat of the day comes back again in the evening, in an opposite pattern to that which flies show here on Earth. Here and there are scattered masses in the shape of pine cones. Their barks are fried by the Sun during the day, but at night, when, so to say, they unfold their secrets, a multitude of living things come out of the hiding place they provide.
In the Subvolvian hemisphere, the clouds and storms are a special form of relief from the heat that often take over half or more of the region”.
When I got to this part of my dream, the wind rose with a noisy rain that disrupted my rest and, in the same time, deleted the end of one of the last books that I brought from Frankfurt. Therefore, leaving behind the Demon, the speaker, and Duracotus, the son, with his mother Fiolxhilda, the listeners, at the point in which their heads had been covered, I returned to my senses, only to find that my head was on a pad and my body wrapped in a blanket.
Johannes Kepler
Somnium | Der Traum
Als im Jahr 1608 Streit zwischen den Brüdern Kaiser Rudolf und Erzherzog Matthias entbrannt war, und man ihre Handlungen allgemein auf Beispiele zurückführte, die aus der Geschichte Böhmens herangezogen waren, wurde ich durch die allgemeine Neugier erregt und wandte mich der Lektüre böhmischer Literatur zu. Dabei stieß ich auf die Geschichte der Heldin Libussa, einer hochberühmten Zauberin; so kam es, dass ich eines Nachts, nachdem ich den Mond und die Sterne betrachtet hatte, behaglich im Bett lag und in tiefen Schlaf fiel. Und ich sah mich im Schlaf ein Buch durchlesen, das ich in Frankfurt auf der Messe erworben hatte, dessen Text folgender war:
Mein Name ist Duracotus, mein Heimatland Island, das die Alten Thule nannten. Meine Mutter war Fiolxhilde, die, da sie jüngst gestorben ist, mir die Erlaubnis zum Schreiben erteilte, auf die ich längst gewartet hatte. Solange sie lebte, gab sie sich alle Mühe, mich vom Schreiben abzuhalten. Sie pflegte nämlich zu sagen, es gebe viele gefährliche Feinde der Künste, die das, was sie wegen der Stumpfheit ihres Geistes nicht fassen können, anprangern und dem Menschengeschlecht ungerechte Gesetze auferlegen würden. Tatsächlich seien nicht wenige aufgrund dieser Gesetze verurteilt und vom Schlund des Hekla verschlungen worden. Den Namen meines Vaters hat sie selbst niemals genannt. Sie behauptete stets, er sei ein Fischer gewesen und als Greis von 150 Jahren gestorben. Als ich drei Jahre alt war, habe er rund 70 Jahre seiner Ehe hinter sich gehabt.
In meinen ersten Knabenjahren führte mich meine Mutter oft, indem sie mich an der Hand nahm, manchmal auch auf die Schulter setzte, auf die niedrigeren Bergjoche des Hekla, besonders um die Zeit des Johannistages, wenn die Sonne 24 Stunden sichtbar ist und die Nacht verdrängt. Sie selbst sammelte Kräuter unter allerlei Riten, kochte sie zu Hause, nähte Säckchen aus Ziegenfell, füllte sie und brachte sie zum Verkauf an Schiffsherren zum nahe gelegenen Hafen. So verdiente sie sich den Lebensunterhalt. Einmal zerriss ich aus Neugier ein Säckchen, das meine ahnungslose Mutter verkaufen wollte, nahm die Kräuter und Leinenläppchen, in welche die verschiedenen Sortenzahlen eingestickt waren, auseinander und brachte so meine Mutter um den Gewinn. Zornentbrannt übergab sie mich anstelle des Säckchens dem Schiffsherrn als Eigentum, um selbst das Geld behalten zu können. Und dieser Schiffsherr brach tags darauf unversehens aus dem Hafen auf und steuerte unter günstigem Wind Bergen in Norwegen an. Als sich nach einigen Tagen der Nordwind erhob, wurde er zwischen England und Norwegen verschlagen, steuerte Dänemark an und fuhr durch die Meerenge, da er einen Brief des isländischen Bischofs dem Dänen Tycho Brahe überbringen sollte. Der wohnte auf der Insel Hveen. Ich aber erkrankte heftig wegen des Schwankens des Schiffes und der ungewohnten Wärme der Luft. Ich war ja noch ein Junge von 14 Jahren. Der Schiffsherr landete und setzte mich zusammen mit dem Brief bei einem Fischer der Insel ab. Er versprach zurückzukommen und legte ab. Als Brahe den Brief erhalten hatte, war er hocherfreut und begann, mich vielerlei zu fragen. Ich verstand das nicht, weil ich seine Sprache nicht konnte, außer wenigen Worten. Daher gab er seinen Studenten, von denen er eine große Zahl betreute, den Auftrag, häufig mit mir zu sprechen. Die Großherzigkeit Brahes und wenige Wochen Übung bewirkten, dass ich einigermaßen gut Dänisch sprechen konnte. Und ich erzählte genauso bereitwillig, wie jene fragten. Da hatte ich freilich viel Ungewohntes zu bestaunen, aber ich konnte aus meinem Vaterland auch viel Neues berichten, das die Zuhörer in Erstaunen versetzte.
Schließlich kehrte der Schiffsherr zurück und wollte mich abholen; aber er holte sich eine Abfuhr, worüber ich mich sehr freute. Auf wunderbare Weise lachten mich die astronomischen Studien an. Denn Brahe und die Studenten betrachteten ganze Nächte lang mit erstaunlichen Geräten den Mond und die Sterne; das erinnerte mich an meine Mutter, die ja auch selbst unablässig mit dem Mond zu sprechen pflegte. Durch diese günstigen Umstände gelangte ich, von Herkunft ein Halbbarbar, an Vermögen völlig mittellos, zur Kenntnis der göttlichen Wissenschaft. Die ebnete mir den Weg zu Höherem. Als ich nämlich ein paar Jahre auf dieser Insel zugebracht hatte, verlangte mich schließlich danach, mein Vaterland wiederzusehen. Ich glaubte nämlich, es könnte mir nicht schwerfallen, mit der erworbenen Wissenschaft bei meinem ungebildeten Volk zu einem gewissen Ansehen zu gelangen. Also verabschiedete ich mich von meinem Gönner, erhielt die huldvolle Erlaubnis zur Abreise und kam nach Kopenhagen. Dort gewann ich Reisegefährten, die mich wegen meiner Sprach- und Ortskenntnis in ihren Schutzbund aufnahmen. Im fünften Jahr, nachdem ich es verlassen hatte, kehrte ich in mein Vaterland zurück.
Das erste Glück meiner Rückkehr war, dass ich meine Mutter noch lebend antraf, in genau derselben Weise beschäftigt wie einst. Ihrer unablässigen Reue darüber, dass sie ihren Sohn durch Unbesonnenheit verloren hatte, setzte ich dadurch ein Ende, dass ich lebendig und angesehen war. Damals neigte sich das Jahr zum Herbst, und es folgten darauf unsere langen Nächte. Denn im Monat der Geburt Christi taucht die Sonne kaum ein wenig auf, um sich auf der Stelle wieder zu verbergen. So war meine Mutter frei von ihrer Tätigkeit und heftete sich an mich, wich nicht von meiner Seite, wohin ich mich auch mit meinen Empfehlungsschreiben begab. Bald fragte sie mich aus über die Länder, die ich bereist hatte, bald über den Himmel. Dass ich diese Wissenschaft studiert hatte, freute sie ganz besonders. Sie verglich, was sie selbst erfahren hatte, mit dem, was ich erzählte, und rief immer wieder aus, jetzt sei sie bereit zu sterben, weil sie als Erben ihrer Wissenschaft, ihres einzigen Besitzes, ihren Sohn zurücklassen werde. Ich, von Natur begierig, Neues zu lernen, befragte sie meinerseits über ihre Künste, und welche Lehrer sie darin gehabt habe in einem Volk, das von den übrigen so sehr getrennt ist. Darauf legte sie an einem bestimmten Tag, an dem wir uns Zeit für ein Gespräch genommen hatten, die ganze Sache von den ersten Anfängen an dar, etwa auf folgende Weise: »Vorzüge, mein Sohn Duracotus, besitzen nicht nur die Länder, die du bereist hast, sondern auch unser Vaterland. Wenn uns nämlich auch Kälte und Finsternis bedrücken und andere Übel, die ich erst jetzt empfinde, nachdem ich durch dich vom Glück der übrigen Länder erfahren habe, so haben wir dagegen Überfluss an Begabungen. Uns stehen zu Diensten hochweise Geister, denen das viele Licht der anderen Länder und der Lärm der Menschen verhasst sind, und die deshalb unsere Schatten aufsuchen und mit uns freundschaftliche Gespräche führen. Von denen sind neun die vorzüglichsten, und einer davon ist mir besonders bekannt; er ist von allen gerade der sanfteste und unschuldigste und wird durch 21 Zeichen herbeigerufen. Mit seiner Hilfe werde ich oft in einem Augenblick zu anderen Küsten, die ich selbst bestimmt habe, entrückt; oder ich kann, wenn ich von irgendwelchen Zielen durch zu große Entfernung abgeschreckt werde, durch Nachfragen so großen Nutzen ziehen, wie wenn ich selbst dort wäre: So hat er mir das meiste von dem, was du entweder mit eigenen Augen gesehen, durch Berichte vernommen oder aus Büchern geschöpft hast, genau so wie du berichtet.
Besonders das Land, von dem er mir so oft gesprochen hat, wünsche ich mit dir gemeinsam zu erkunden. Sehr wundersam ist nämlich, was er von ihm erzählt. Levania, so nannte er es.« Unverzüglich stimme ich zu, dass sie ihren Meister herbeiruft, und setze mich, um die ganze Beschaffenheit des Weges und die Beschreibung des Landes anzuhören. Es war schon Frühling und zunehmender Mond, der, sobald die Sonne unter den Horizont getaucht war, in Konjunktion mit dem Planeten Saturn im Zeichen des Stiers aufzustrahlen begann. Die Mutter ging voraus bis zur nächsten Weggabelung, erhob ein Geschrei und brachte einige wenige Wörter hervor, mit denen die sie ihre Bitte äußerte. Nachdem sie ihre Riten vollendet hat, kehrt sie zurück, gebietet mit ausgestreckter rechter Hand Schweigen und setzt sich neben mich. Kaum hatten wir das Haupt mit dem Gewand (wie es vereinbart war) verhüllt, da erhebt sich das Gekrächz einer stammelnden und dumpfen Stimme. Und sofort beginnt sie auf folgende Weise zu sprechen, aber in isländischer Sprache.
Der Dämon aus Levania.
50000 deutsche Meilen entfernt liegt in der Tiefe des Äthers die Insel Levania. Der Weg von hier dorthin oder von dort hierher steht nur sehr selten offen. Und wenn er offensteht, kann unser Volk ihn zwar leicht beschreiben, für menschliche Reisende ist er aber ganz schwierig und mit höchster Lebensgefahr verbunden. Keine Freunde sitzender Lebensweise werden von uns in unsere Gemeinschaft aufgenommen, keine dicken, keine verzärtelten Leute. Vielmehr wählen wir die aus, die ihr Leben lang ständig auf schnellen Pferden reiten, oder die häufig nach Indien segeln; sie müssen daran gewöhnt sein, sich von Zwieback, Knoblauch, Dörrfisch und abscheulichen Speisen zu ernähren. Besonders eignen sich für uns saftlose alte Weiber, die von Kindheit an mit der Kunst vertraut sind, nachts auf Böcken, Astgabeln oder zerschlissenen Mänteln zu reiten und riesenhafte Entfernungen zwischen Ländern zu überwinden. Deutsche Männer sind überhaupt nicht geeignet. Spanier mit ihren drahtigen Körpern nehmen wir gerne auf. So lang der ganze Weg auch ist, er wird in höchstens vier Stunden zurückgelegt. Und da wir immer sehr beschäftigt sind, steht für uns der Zeitpunkt der Abreise nämlich nicht früher fest, als bis der Mond von Osten her angefangen hat abzunehmen. Sind wir bei Vollmond noch auf dem Weg, wird unsere Reise unmöglich gemacht. Da die Reisegelegenheit sich immer so kurzfristig ergibt, haben wir vom Menschengeschlecht wenige Genossen, und nur solche, die uns die größte Hochachtung entgegenbringen. Also gehen wir auf einen so gearteten Menschen los, indem wir eine Mannschaft bilden, uns alle unter ihn stemmen und ihn in die Höhe heben. Die erste Bewegung ist jeweils für ihn die härteste. Denn er ist keinen geringeren Strapazen ausgesetzt, als wenn er, von Sprengpulver hochgeschossen, über Berge und Meere schwebte. Deswegen 68 muss er gleich anfangs mit Narkotika und Opiaten eingeschläfert und Glied für Glied auseinandergefaltet werden, damit nicht der Rumpf vom Hintern, der Kopf vom Rumpf getrennt davongetragen wird, sondern der Druck auf die einzelnen Glieder sich gleichmäßig verteilt. Darauf folgt die nächste Schwierigkeit, nämlich ungeheure Kälte und Atemnot. Jener treten wir mit der uns angeborenen Kraft entgegen, dieser mit feuchten Lappen, die wir vor die Nase halten. Ist der erste Teil überstanden, wird die Reise leichter. Dann setzen wir die Körper der freien Luft aus und ziehen die Hände weg. Die Körper aber kugeln sich ein wie Spinnen, wir bewegen sie fast nur noch mit unserem Willen, so dass schließlich die Körpermasse selbst zu dem vorgesehenen Platz strebt. Aber diese Schwungkraft ist für uns zu langsam und deshalb von geringem Nutzen. Daher beschleunigen wir sie, wie gesagt, durch unseren Willen. Und wir eilen nun dem Körper voraus, damit er nicht durch allzu harten Aufprall auf dem Mond Schaden nimmt. Wenn die Menschen erwachen, klagen sie immer über unsägliche Schlappheit aller Glieder. Davon erholen sie sich erst spät so weit, dass sie gehen können.
Außerdem treten viele Schwierigkeiten auf, über die zu berichten zu lange dauern würde. Uns stößt fast gar kein Übel zu. Wir wohnen nämlich dichtgedrängt im Erdschatten, solange er dauert. Sobald er Levania berührt, sind wir zur Stelle, als wenn wir aus einem Schiff an Land gingen. Und dort ziehen wir uns rasch in Höhlen und dunkle Orte zurück, damit uns die Sonne, sobald sie uns in offenem Gelände bestrahlt, nicht aus dem gewählten Aufenthaltsort vertreibt und zwingt, dem weichenden Schatten zu folgen. Dort haben wir Muße, unsere Talente nach Herzenslust auszubilden. Wir unterhalten uns mit den Dämonen dieser Gegend, schließen Freundschaft mit ihnen, und sobald die Sonne ein Gebiet verlässt, schließen wir uns zu Gruppen zusammen und wandeln im Schatten, und wenn dieser mit seiner Schärfe — was meistens geschieht — die Erde trifft, wenden auch wir uns der Erde 86 mit gemeinschaftlichen Unternehmungen zu. Das ist nur zu Zeiten möglich, wenn die Menschen die Sonne verfinstert sehen. Daher kommt es, dass Sonnenfinsternisse so sehr gefürchtet werden. Und das soll genug sein über den Weg nach Levania. Ich fahre fort, indem ich von der Beschaffenheit des Landes selbst berichte; ich beginne nach Art der Geographen mit dem, was von dort aus gesehen am Himmel geschieht. Zwar ist der Anblick der Fixsterne für ganz Levania derselbe wie für uns. Jedoch beobachtet man dort Bewegungen und Größen der Planeten, die von den uns sichtbaren völlig verschieden sind, und zwar so sehr, dass bei ihnen die ganze Wissenschaft der Astronomie vollkommen verschieden ist.
Wie also unsere Geographen den ganzen Erdkreis wegen der Himmelserscheinungen in fünf Zonen aufteilen, so besteht Levania aus zwei Halbkugeln, einer der Subvolven (subvolvae) und einer der Privolven (privolvae). Von diesen genießt jene unablässig den Anblick ihrer Volva, die für sie das ist, was für uns der Mond; diese aber bekommt die Volva niemals zu sehen. Der Kreis, der die Halbkugeln voneinander trennt, verläuft durch 91 die Pole der Welt hindurch, entsprechend unserem Sonnenwend-Kolur, und wird Divisor (Teiler) genannt. Was beiden Halbkugeln gemeinsam ist, will ich zuerst erklären. Also: Ganz Levania erlebt den Wechsel von Tag und Nacht, wie wir. Aber es fehlt die Verschiedenheit im Laufe des Jahres, die wir hier bei uns haben. In ganz Levania nämlich sind die Tage den Nächten annähernd gleich, außer dass bei den Privolven regelmäßig jeder Tag kürzer ist als die zugehörige Nacht, bei den Subvolven umgekehrt. Was aber während des Umlaufs von acht Jahren wechselt, soll weiter unten gesagt werden. Unter beiden Polen aber ist die Sonne zur Hälfte verdeckt, die andere Hälfte leuchtet. Das gleicht die Nacht aus. Die Sonne umkreist die Berge. Levania scheint nämlich ihren Bewohnern genau so festzustehen und von den Gestirnen umkreist zu werden, wie uns die Erde. Nacht und Tag zusammen entsprechen einem unserer Monate. Bei Sonnenaufgang erscheint natürlich das Tierkreiszeichen des heraufziehenden Tages vollständiger als am Vortage. Und wie bei uns das Jahr 365 Sonnenumläufe und 366 Fixsternumläufe hat — oder genauer: in vier Jahren 1461 Sonnenumläufe, aber 1465 Fixsternumläufe —, so haben jene in einem Jahr zwölf Sonnenumläufe und 13 Fixsternumläufe ― oder genauer: in acht Jahren 99 Sonnenumläufe und 107 Fixsternumläufe. Aber vertrauter ist ihnen selbst eine Periode von 19 Jahren. Denn in dieser Zeitspanne geht die Sonne 135mal auf, die Fixsterne aber 254mal. Den mittleren oder innersten Subvolven geht die Sonne auf, wenn bei uns das letzte Viertel erscheint, den innersten Privolven aber dann, wenn bei uns das erste Viertel zu sehen ist. Was ich aber von der jeweiligen Mitte sage, muss man jeweils auf den ganzen Halbkreis beziehen, der durch die Pole und den Mittelkreis läuft und mit dem Divisor einen rechten Winkel bildet. Diese Halbkreise könnte man Medivolvane nennen.
Es gibt aber einen Kreis in der Mitte zwischen den Polen, der unserem Äquator entspricht. Mit diesem Namen soll er auch bezeichnet werden. Er schneidet an zwei Stellen den Divisor und die Medivolvane an einander gegenüberliegenden Stellen. Die Scheitelpunkte aller Orte, die auf ihm liegen, überquert die Sonne täglich in kürzestem Abstand, und zwar genau an zwei im Lauf des Jahres einander gegenüberliegenden Tagen im Mittagspunkt. Für die übrigen Leute, die beiderseits gegen die Pole hin wohnen, weicht die Sonne am Mittag von der Senkrechten ab. Man kennt in Levania auch einen geringen Unterschied zwischen Sommer und Winter, der aber nicht mit dem unsrigen zu vergleichen ist; auch treten diese Jahreszeiten nicht immer an denselben Orten und zur selben Zeit des Jahres auf, wie bei uns. In einem Zeitraum von zehn Jahren nämlich wandert jener Sommer an ein und demselben Ort von einem Teil des Gestirnjahres in den entgegengesetzten Teil; denn im Ablauf von 19 Gestirnjahren oder 235 Tagen herrscht an den Polen zwanzigmal der Sommer, genau so oft der Winter, am Äquator vierzigmal. Bei ihnen gibt es jährlich sechs Sommertage, das übrige sind Wintertage, wie bei uns die Monate. Dieser Unterschied ist am Äquator kaum spürbar, weil die Sonne dort nicht mehr als fünf Grad nach beiden Seiten hin abweicht. Stärker spürt man den Unterschied an den Polen. Dort scheint die Sonne wechselweise sechs Monate und sechs Monate nicht, wie auch bei uns in jenen Ländern, die nahe den Polen liegen. Daher ist auch die Levania-Kugel in fünf Zonen geteilt, die unseren Erd-Zonen in etwa entsprechen. Aber die dürre Zone wie auch die kalten Zonen umfassen kaum zehn Grad. Der ganze Rest entspricht unseren gemäßigten Zonen. Die Dürrezone läuft um die Mitte der Halbkugeln, nämlich die Hälfte ihrer Länge bei den Subvolven, die andere Hälfte bei den Privolven.
Aus den Schnittstellen des Äquators und des Tierkreises ergeben sich auch vier Kardinalpunkte, entsprechend unseren Äquinoktien und Solstitien, und von diesen Schnittstellen an beginnt der Tierkreis. Die Bewegung der Fixsterne von diesem Anfang zum Folgenden ist sehr schnell. Denn sie durchlaufen in zwanzig tropischen Jahren, die durch einen Sommer und einen Winter definiert sind, den ganzen Tierkreis, was bei uns kaum in 26000 Jahren geschieht. Soviel zur ersten Bewegung! Das Wesen der zweiten Bewegungen ist genau so verschieden von denen, die uns erscheinen, und viel komplizierter. Denn bei allen sechs Planeten — Saturn, Jupiter, Mars, Sonne, Venus, Merkur — treten neben den vielen Ungleichheiten, die uns und ihnen gemeinsam sind, bei ihnen drei weitere hinzu, zwei Ungleichheiten der Länge: eine täglich, die andere im Verlauf von 8½ Jahren; die dritte Ungleichheit ist die der Breite: im Verlauf von 19 Jahren. Die mittleren Privolven sehen die Sonne an ihrem Mittag (bei sonst gleichen Bedingungen) größer, die Subvolven kleiner als beim Aufgang. Beide glauben übereinstimmend, dass die Sonne einige Minuten von der Ekliptik hin und her abweiche, bald bei diesen, bald bei jenen Fixsternen. Und diese Abweichungen werden nach 19 Jahren, wie gesagt, in die ursprüngliche Bahn zurückgelenkt. Ein wenig mehr jedoch beträgt diese Abweichung bei den Privolven, etwas weniger bei den Subvolven. Und obwohl man annimmt, dass die Sonne und die Fixsterne bei der ersten Bewegung beinahe gleichförmig um Levania kreisen, bewegt sich für die Privolven die Sonne am Mittag dennoch beinahe gar nicht unter den Fixsternen vorwärts, bei den Subvolven ist aber am Mittag ihre Bewegung sehr schnell. Das Gegenteil soll von der Mitternacht gelten. Sosehr scheint die Sonne unter den Fixsternen gleichsam Sprünge zu machen, und zwar einzelne an einzelnen Tagen. Dasselbe gilt für Venus, Merkur und Mars. Bei Jupiter und Saturn sind diese Dinge fast nicht bemerkbar. Und doch ist die Bewegung nicht einmal sich selbst gleich, die täglich zu den gleichen Stunden stattfindet. Manchmal ist sie langsamer bei der Sonne und ebenso bei den Fixsternen, im entgegengesetzten Teil des Jahres aber schneller zur gleichen Tageszeit. Diese Verlangsamung wandert durch die Tage des Jahres, so dass sie bald im Sommer auftritt, bald im Winter, entsprechend dem anderen Jahr, das die Beschleunigung erlebt hatte. Ein Umlauf vollzieht sich in einem Zeitraum von etwas weniger als neun Jahren. Und so dauert bald der Tag länger (durch natürliche Langsamkeit, nicht wie bei uns auf der Erde durch die ungleichen Abschnitte des natürlichen Tageskreises), bald wechselweise die Nacht.
Tritt die Verlangsamung bei den Privolven zur Mitternacht ein, verschiebt sich ihr Verlauf über den Tag hin. Tritt sie am Tag ein, dann gleichen sich Nacht und Tag mehr an; das geschieht einmal in neun Jahren, umgekehrt bei den Subvolven. Soviel also über das, was in den beiden Hemisphären ungefähr in gleicher Weise geschieht.
Über die Hemisphäre der Privolven.
Was nun die einzelnen Hemisphären getrennt betrifft, so besteht zwischen ihnen ein ungeheuer großer Unterschied. Nicht nur bewirkt die Gegenwart oder Abwesenheit der Volva einen ganz ungleichen Anblick, sondern auch die gemeinsamen Phänomene selbst haben hier und dort ganz verschiedene Wirkungen, so dass die Hemisphäre der Privolven eher als extrem bezeichnet werden könnte, die der Subvolven als gemäßigt. Denn bei den Privolven dauert die Nacht 15 oder 16 unserer natürlichen Tage an, unter ständiger schrecklicher Finsternis, wie bei uns die mondlosen Nächte sind, da diese Nacht nicht einmal durch irgendwelche Abstrahlungen der Volva jemals erleuchtet wird. Daher starrt alles vor Kälte und Reif und darüber hinaus vor ganz steifen und starken Winden. Es folgt der Tag, 14mal so lang wie unsere Tage117, oder etwas weniger als dies, an dem die Sonne sowohl größer ist als sich auch unter den Fixsternen nur langsam bewegt und sich kein Wind regt. Daher kommt es zu ungeheurer Hitze. Und so herrscht im Zeitraum eines Erdmonats oder eines levanianischen Tages an ein und demselben Ort sowohl Hitze, fünfzehnmal kochender als unsere afrikanische, und Kälte, unerträglicher als unsere hiesige. Besonders zu bemerken ist, dass der Planet Mars den Privolven der Mittelzone um Mitternacht, den übrigen je in ihrem Abschnitt der Nacht, bisweilen beinahe doppelt so groß erscheint wie uns.
Über die Hemisphäre der Subvolven.
Ich gehe dazu über, indem ich mit ihren Randbewohnern beginne, die am Divisor-Kreis leben. Ihnen ist nämlich eigentümlich, dass ihnen der Abstand der Venus und des Merkurs von der Sonne viel größer erscheint als uns. Auch scheint ihnen die Venus zu bestimmten Zeiten doppelt so groß wie uns, besonders denen, die am Nordpol wohnen. Die angenehmste Betrachtung aller Leute in Levania ist die ihrer Volva, deren Anblick sie in gleichem Maß genießen wie wir den unseres Mondes. Der ist ihnen, wie auch besonders den Privolven, vollständig versagt. Und nach der beständigen Gegenwart der Volva heißt diese Hemisphäre die subvolvene, der andere nach der Abwesenheit der Volva der privolvene, weil sie des Anblicks der Volva beraubt sind. Uns Erdbewohnern scheint unser Mond, wenn er voll ist, beim Aufgang und auf seinem Weg über weit entfernte Häuser die Größe eines Fassreifens zu haben. Sobald er in die Mitte des Himmels aufgestiegen ist, entspricht sein Umfang kaum dem eines menschlichen Gesichts. Die Subvolven aber sehen ihre Volva genau im Himmelsmittelpunkt (diese Stelle nimmt sie ein bei denen, die in der Mitte oder am Nabel dieser Hemisphäre wohnen) mit beinahe der vierfach größeren Länge des Durchmessers als wir unseren Mond sehen, so dass, wenn man beide vergleicht, ihre Volva fünfzehnmal größer ist als unser Mond. Für die aber, für welche die Volva unablässig am Horizont klebt, hat sie von ferne das Aussehen eines glühenden Berges.
Wie wir also die Regionen unterscheiden durch die größere oder geringere Polhöhe, obwohl wir den Pol selbst nicht mit Augen sehen, so dient ihnen zu demselben Zweck die Höhe der Volva, die immer sichtbar ist, verschieden an verschiedenen Orten. Bei einigen nämlich steht sie, wie gesagt, über dem Scheitel, an anderen Orten scheint sie nahe an den Horizont herabgedrückt zu sein. Für den Rest ist sie von der Scheitelhöhe bis zum Horizont jeweils geneigt und nimmt dabei für jeden beliebigen Ort für immer eine konstante Höhe ein. Sie haben selbst ihre eigenen Pole, nicht jedoch bei jenen Fixsternen, die für uns die Weltenpole sind, sondern bei anderen, die für uns die Anzeichen der Ekliptik der Pole sind. Diese Pole beschreiben im Zeitraum von 19 Mondjahren unter dem Sternbild des Drachen, des gegenüberliegenden Schwertfisches, des Fliegenden Fisches und der Meereswolke kleine Kreise um die Pole der Ekliptik; diese Pole sind ungefähr einen Viertelkreis von denen der Volva entfernt, so dass man einen Ort sowohl anhand der Pole als auch anhand der Volva bestimmen kann. Daher ist es ganz klar, wie sehr die Mondbewohner selbst uns an Bequemlichkeit überlegen sind. Die Länge der Orte bestimmen sie durch ihre unbewegliche Volva, die Breite sowohl durch ihre Volva als auch durch die Pole. Wir hingegen haben für die Bestimmung der Längen nichts als jenen so sehr verachteten und kaum unterscheidbaren Ausschlag der Magnetnadel.
Für die Bewohner steht also ihre Volva fest, als wäre sie mit einem Nagel an den Himmel geheftet, unbeweglich, was den Ort angeht, und über sie gehen die übrigen Sterne, sogar die Sonne selbst, vom Aufgang bis zum Untergang hin. Und keine Nacht gibt es, in der nicht irgendwelche Fixsterne des Tierkreises sich hinter diese Volva zurückziehen und dann auf der anderen Seite wieder auftauchen. Doch nicht in allen Nächten tun das dieselben Fixsterne, sondern sie wechseln sich untereinander ab, alle diejenigen, die von der Ekliptik sechs oder sieben Grad entfernt sind; es vollzieht sich im Verlauf von 19 Jahren nämlich eine Periode, danach beginnt der Kreislauf von vorn. Ihre Volva nimmt zu und ab genau wie unser Mond. Der Grund ist bei beiden derselbe, nämlich die Anwesenheit der Sonne oder die Entfernung von ihr. Auch die Zeit ist dieselbe, wenn man das Wesen der Sache betrachtet. Doch zählen jene anders als wir. Jene rechnen als einen Tag und eine Nacht die Zeit, in der sich alle Zunahmen und Abnahmen der Volva vollziehen; den Zeitraum nennen wir einen Monat. Fast niemals freilich, nicht einmal bei Neu-Volva, ist die Volva bei den Subvolven unsichtbar, wegen ihrer Größe und Helligkeit. Das gilt besonders für die Polbewohner, die zeitweilig zwar die Sonne nicht sehen, für die aber die Volva gerade im Intervolvium zur Mittagszeit die Hörner aufwärts wendet. Denn im Allgemeinen ist für diejenigen, die zwischen der Volva-Breite und den Polen sowie unter dem medivolvanischen Kreis wohnen, das Neu-Volvium das Zeichen des Mittags, das erste Viertel das des Abends; das Voll-Volvium teilt die Nacht in gleiche Teile, und das letzte Viertel führt die Sonne zurück. Für diejenigen aber, welche die Pole und die Volva am Horizont sehen, und die unter dem Schnittpunkt des Äquators mit dem Divisor wohnen, bringen das Neu-Volvium und Voll-Volvium Morgen und Abend, die Viertel die Teilung des Tages und der Nacht. Hieraus kann man sich auch ein Bild über die dazwischen Wohnenden machen. Und am Tag unterscheiden sie die Stunden auf folgende Weise, nämlich jeweils nach den Phasen ihrer Volva: Je näher Sonne und Volva zueinander stehen, umso näher rückt den einen der Mittag, den anderen der Abend oder Sonnenuntergang. Für die Nacht aber, die regelmäßig 14 unserer Tage und Nächte dauert, haben sie viel mehr Hinweise zur Zeitmessung, als wir. Denn außer jener Abfolge der Phasen der Volva, von denen das Voll-Volvium — wie gesagt — die Mitternacht anzeigt für ihr Medivolvanum, zeigt auch ihre Volva ihnen durch sich selbst die Stunden an. Obwohl man sie sich nämlich überhaupt nicht vom Ort bewegen sieht, vollführt sie an ihrem Platz eine Kreisbewegung um sich selbst, im Gegensatz zu unserem Mond, und zeigt nacheinander eine bewundernswerte Fülle verschiedener Flecken, die sich beständig von Osten nach Westen verschieben. Eine solche Umdrehung also betrachten die Subvolven, wenn dieselben Flecken wiederkehren, als eine Zeitstunde. Dem entspricht aber etwas mehr als ein Tag und eine Nacht bei uns: Und das ist die einzige vergleichbare Zeitmessung. Denn die Sonne und die Sterne durchlaufen, wie oben gesagt, ihre Bahn für die Mondbewohner täglich in verschiedener Zeit: Weil gerade am meisten diese Umkreisung der Volva die Entfernungen der Fixsterne vom Mond im Vergleich zu ihr bewirkt. Im Allgemeinen scheint diese Volva, was den oberen nördlichen Teil angeht, zwei Hälften zu haben, eine dunklere und mit zusammenhängenden Flecken bedeckte und eine leicht hellere. Als Trennung liegt zwischen beiden ein heller Gürtel zum Norden hin. Die Gestalt ist schwer zu erklären. Doch erkennt man im östlichen Teil etwas wie das Profil eines Menschen, in Höhe der Achseln abgeschnitten, der sich ein Mädchen zum Küssen heranzieht, das in ein langes Gewand gehüllt ist und mit nach hinten ausgestreckter Hand eine heranspringende Katze reizt. Doch der größere und breitere Teil des Fleckens springt ohne bestimmbare Form nach Westen vor.
Die andere Hälfte der Volva besteht aus mehr hellerer Fläche und einem Fleck. Man könnte diesen das Bild einer Glocke nennen, die an einem Seil hängt und nach Westen geschwungen ist. Was darüber und darunter ist, kann man nicht identifizieren.
Und nicht genug damit, dass die Volva ihnen auf diese Weise die Stunden des Tages unterscheidet. Vielmehr gibt sie auch auf die Jahreszeiten klare Hinweise, wenn man darauf achtet oder wenn einem die Lehre von den Fixsternen unbekannt ist. Steht die Sonne im Krebs, zeigt die Volva auch deutlich den Nordpol ihrer Rotation. Da ist nämlich ein kleiner und runder Fleck, über dem Bild des Mädchens, mitten in den hellen Bezirk eingepflanzt. Der wandert vom höchsten, äußersten Teil der Volva nach Osten, steigt von hier in die Scheibe ab, wendet sich nach dem äußersten Westen, von wo er wieder zur Höhe der Volva in Richtung Osten zurückkehrt; und so ist er während der ganzen Zeit ununterbrochen sichtbar. Wenn aber die Sonne im Steinbock steht, ist dieser Fleck nirgends zu sehen: Sein ganzer Umlauf ist zusammen mit seinem Pol hinter dem Körper der Volva versteckt. Und in diesen beiden Teilen des Jahres streben die Flecken geradewegs nach Westen. In den Zwischenzeiten, wenn die Sonne im Widder resp. in der Waage steht, steigen die Flecken in leicht gebogener Linie entweder querhin ab, oder sie steigen auf. Hieraus erkennen wir auch, dass die Pole dieser Rotation, während der Mittelpunkt des Volva-Körpers an seinem Ort bleibt, im Jahr einmal im Polarkreis um ihren Pol kreisen. Wer genauer beobachtet, bemerkt auch, dass die Volva nicht immer dieselbe Größe behält. In den Stunden des Tages nämlich, in denen die Sterne sich schnell bewegen, sieht er, dass der Durchmesser der Volva viel größer ist, so dass er dann insgesamt das Vierfache unseres Mondes übersteigt. Was soll ich aber nun über die Finsternisse der Sonne und der Volva sagen, die in Levania sich ereignen, und zwar im selben Augenblick wie hier auf der Erdkugel die Finsternisse der Sonne und des Mondes, allerdings aus ganz entgegengesetzten Gründen? Denn wenn sich uns die Sonne ganz verfinstert, verfinstert sich ihnen die Volva. Wenn umgekehrt uns sich unser Mond verfinstert, verfinstert sich bei ihnen die Sonne. Dennoch aber passt nicht alles genau zusammen. Oft nämlich sehen die Mondbewohner eine Teilfinsternis der Sonne, wenn wir den Mond ganz sehen. Und umgekehrt: Sie sind nicht selten von einer Erdverfinsterung gar nicht betroffen, während wir eine Teil-Verfinsterung der Sonne erleben. Volvafinsternisse gibt es bei ihnen während der Voll-Volvien, wie bei uns Mondfinsternisse bei Vollmond, Sonnenfinsternisse aber sehen sie bei Neu-Volvien, wie wir hier bei Neumond.
Da ihre Tage und Nächte so lang sind, haben sie sehr häufig Finsternisse beider Gestirne. Anstatt dass wie bei uns ein großer Teil der Finsternisse zu den Antipoden hinüberwandert, sehen ihre Antipoden, da sie ja Privolven sind, überhaupt nichts von diesen Erscheinungen, die Subvolven hingegen erleben allein alles. Eine totale Erdfinsternis sehen sie nie. Vielmehr gleitet über den Körper der Volva ein kleiner runder Fleck, rot am Rand, schwarz in der Mitte, der im Osten der Volva auftritt und am Westrand wieder verschwindet; er nimmt zwar denselben Weg wie die ursprünglichen Flecken, übertrifft sie aber an Schnelligkeit. Das dauert ein Sechstel ihrer Stunde, oder vier unserer Stunden. Die Ursache der Sonnenfinsternisse ist für sie ihre Volva, genau wie für uns unser Mond. Da diese Volva einen viermal größeren Durchmesser hat als die Sonne, muss die Sonne, die sich vom Osten durch den Süden hinter der unbeweglichen Volva zum Westen bewegt, sehr häufig hinter der Volva verschwinden. Und so wird ein Teil der Sonne oder ihr ganzer Körper verdeckt. Es ist aber die völlige Verschattung der Sonne, obzwar häufig, so doch sehr bemerkenswert, weil sie einige unserer Stunden dauert und das Licht beider, der Sonne und der Volva, zugleich verlöscht. Das ist bei den Subvolven ein großes Ereignis, weil ihre Nächte sonst nicht viel dunkler als die Tage sind wegen des Glanzes und der Größe der allzeit gegenwärtigen Volva, während bei Sonnenfinsternis für sie beide Lichtquellen, Sonne und Volva, ausgelöscht sind.
Dennoch zeigt sich während der Sonnenfinsternisse bei ihnen dieses einzigartige Phänomen, das sehr häufig auftritt, dass, wenn die Sonne kaum hinter dem Körper der Volva verschwunden ist, auf der entgegengesetzten Seite ein Glanz entsteht, als ob die Sonne gedehnt wäre und den ganzen Körper der Volva umfasste, während doch sonst die Sonne um vieles kleiner erscheint als die Volva. Daher ist die Finsternis nicht immer vollständig, sondern nur, wenn auch die Mittelpunkte der Körper fast auf einer Linie liegen und ein durchscheinendes Medium es erlaubt. Aber auch die Volva verlöscht nicht plötzlich so, dass sie unsichtbar würde, obwohl die Sonne gänzlich hinter ihr verschwunden ist, sondern nur im mittleren Abschnitt der größten Dunkelheit. Am Anfang einer totalen Finsternis dämmert für einige Punkte des Divisors die Volva noch, wie wenn nach Verlöschen einer Flamme noch lebendige Glut übrig bleibt. Wenn dieser Dämmerschein auch erloschen ist, erreicht die größte Finsternis die Mitte ihrer Dauer (denn nur bei größter Finsternis erlischt dieser Dämmerschein). Wenn aber der Dämmerschein der Volva zurückkehrt (am entgegengesetzten Teil des Divisors), naht auch der Anblick der Sonne heran. So verlöschen gewissermaßen beide Lichtquellen gleichzeitig in der Mitte der größten Finsternis. Und das ist genug über die Erscheinungen in beiden Hemisphären von Levania, sowohl der subvolvenen wie der privolvenen. Daraus ist es nicht schwer zu beurteilen — auch wenn ich nichts darüber sage —, wie sehr sich die Subvolven von den Privolven in den übrigen Gegebenheiten unterscheiden. Denn obwohl die Nacht der Subvolven 14 unserer Nachttage dauert, erhellt die Gegenwart der Volva dennoch die Landflächen und schützt sie vor Kälte. Eine so große Masse nämlich und so große Leuchtkraft muss notwendig Wärme erzeugen. Umgekehrt: Zwar bringt der Tag bei den Subvolven die lästige Gegenwart der Sonne für 15 oder 16 unserer Nächte und Tage mit sich, doch ist die Sonne kleiner und besitzt nicht so feindliche Kräfte, und die vereinigten Lichtquellen ziehen auf diese Hemisphäre alles Wasser, das die Landstriche überflutet, so dass kaum etwas von ihnen übrig ist; hingegen trocknet und kühlt die privolvene Hemisphäre aus, da ihr alles Wasser entzogen ist. In der folgenden Nacht bei den Subvolven, dem Tag bei den Privolven, teilt sich, da die Hemisphären untereinander die Lichtquellen aufgeteilt haben, auch das Wasser. Bei den Subvolven wird das Land wieder frei, den Privolven aber wird Feuchtigkeit zuteil als kleiner Trost gegen die Hitze.
Da der Umfang der ganzen Levania nicht mehr als 1400 deutsche Meilen beträgt — das ist gerade nur der vierte Teil unserer Erde —, hat sie dennoch sehr hohe Berge sowie sehr tiefe und weite Täler; daher steht sie an Vollkommenheit der Rundung weit hinter unserer Erde zurück. Sie ist mittlerweile ganz porös und von Löchern und Höhlen gleichsam durchbohrt, am meisten auf der privolvenen Seite. Das gibt den Bewohnern hauptsächlich Schutz gegen Hitze und Kälte. Alles, was auf der Erde wächst oder über den Boden einherschreitet, ist von riesenhafter Größe. Das Wachstum geschieht sehr schnell; alles ist kurzlebig, weil es zu so ungeheurer Körpergröße heranwachsen muss. Die Privolven haben keinen sicheren Unterschlupf, keinen festen Wohnsitz. Die ganze Kugel durchstreifen sie in Gruppen an einem einzigen ihrer Tage, so wie es die Natur eines jeden erlaubt: Teils zu Fuß, mit Beinen, die bei Weitem länger sind als die unserer Kamele, teils mit Flügeln, teils mit Schiffen folgen sie den zurückweichenden Wassern; oder wenn ein Aufenthalt von mehreren Tagen nötig ist, dann kriechen sie durch die Höhlen. Die meisten sind Taucher. Alle ziehen, wenn sie natürlich atmen, die Luft sehr langsam ein. Unter Wasser können sie sich also in der Tiefe aufhalten, indem sie der Natur durch Kunst zur Hilfe kommen. Sie sagen nämlich, in jenen Wassertiefen erhalte sich die Kühle, während die oberen Wellen von der Sonne erhitzt würden. Alles, was an der Oberfläche hängen bleibt, wird von der Sonne am Mittag gesotten und dient den ankommenden Wandersiedlern als Nahrung. Denn im Allgemeinen ist die subvolvene Hemisphäre unseren Dörfern, Städten und Gärten vergleichbar, die privolvene unseren Äckern, Wäldern und Wüsten.
Diejenigen, die ein stärkeres Bedürfnis nach Atem haben, leiten heißes Wasser durch einen engen Kanal in die Höhlen, damit es, durch den langen Weg in den innersten Teil geführt, sich allmählich abkühlt. Dort halten sie sich den größten Teil des Tages auf und genießen jenes Wasser als Trank. Wenn es Abend wird, kommen sie hervor, um sich draußen Nahrung zu verschaffen. Bei den Pflanzen hüllt eine Rinde, bei den Tieren ein Fell oder etwas Ähnliches den größeren Teil der Körpermasse ein. Es ist schwammig und porös. Und wenn etwas während des Tages angefasst worden ist, verhärtet es sich an der Oberfläche und wird versengt. Wenn der Abend kommt, fällt es ab. Was die Erde hervorbringt — auf den Bergjochen ist das natürlich wenig —, entsteht und vergeht meistens innerhalb eines Tages; und täglich wächst Neues nach. Die Tiergattung der Schlangen herrscht ganz allgemein vor. Es gleicht einem Wunder, dass sie sich am Mittag der Sonne aussetzen, als wenn ihnen das Lust verschaffte, jedoch nirgendwo anders als in der Nähe der Höhlenöffnungen, damit sie sich den sicheren und raschen Rückzug offenhalten. Einigen vergeht während der Tageshitze der Atem, und das Leben erlischt. Während der Nacht erholen sie sich wieder, auf umgekehrte Weise wie bei uns die Fliegen. Überall auf dem Boden verstreut liegen Gegenstände, die wie Pinienzapfen geformt sind. Tagsüber ist ihre Rinde angesengt, abends öffnen sie sich und geben, wie aus einem Versteck, Lebewesen von sich. Die hauptsächliche Linderung der Hitze besteht auf der subvolvenen Hemisphäre aus beständigen Wolken und Regenfällen, die manchmal die Hälfte der Fläche oder mehr beherrschen. Als ich in meinem Traum bis hierhin gekommen war, riss mich ein Sturm mit prasselndem Regen aus dem Schlaf, und zugleich verlor sich das Ende des in Frankfurt beschafften Buches. Und so verließ ich den erzählenden Dämon und die Zuhörer, den Sohn Duracotus mit seiner Mutter Fiolxhilde, deren Häupter verhüllt waren, kehrte zu mir selbst zurück und fand tatsächlich meinen Kopf auf dem Kissen und meinen Körper in Decken gehüllt.