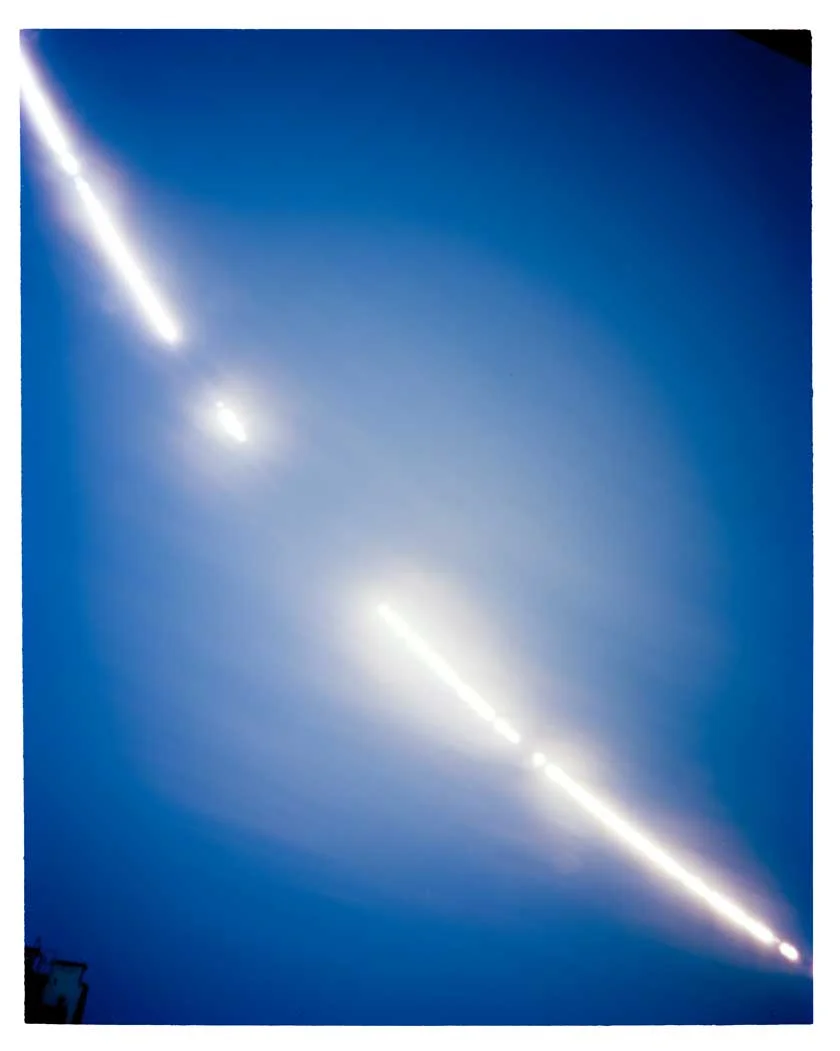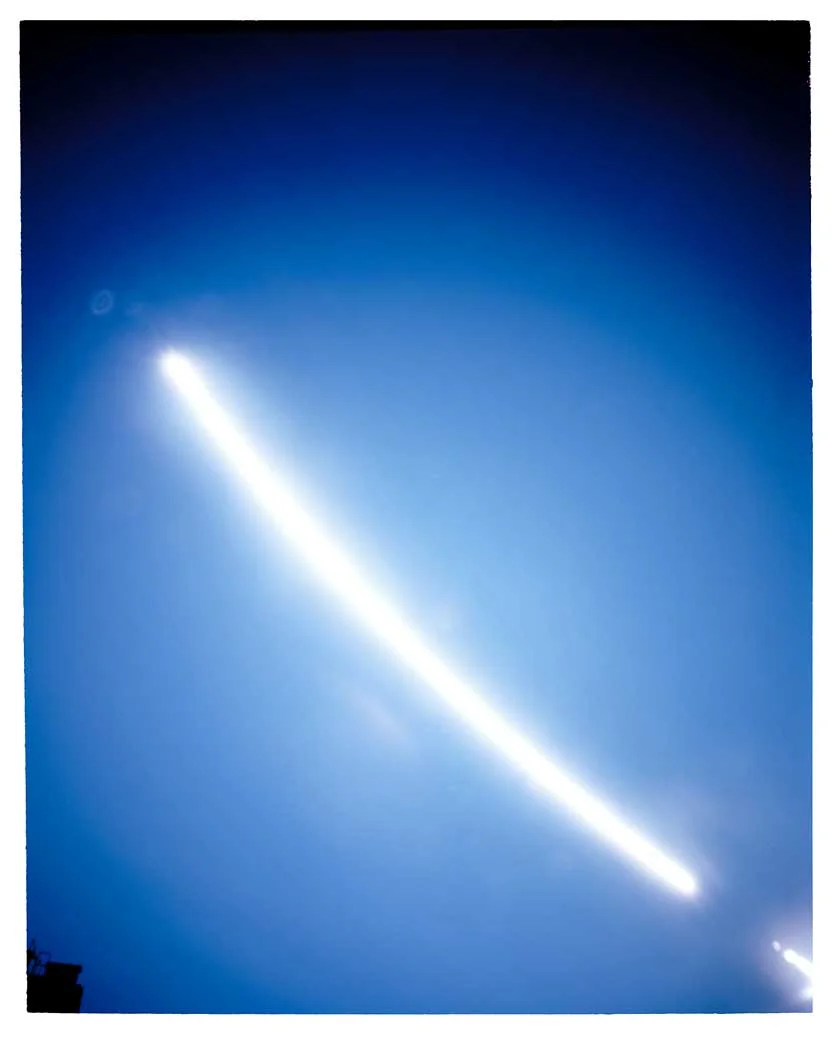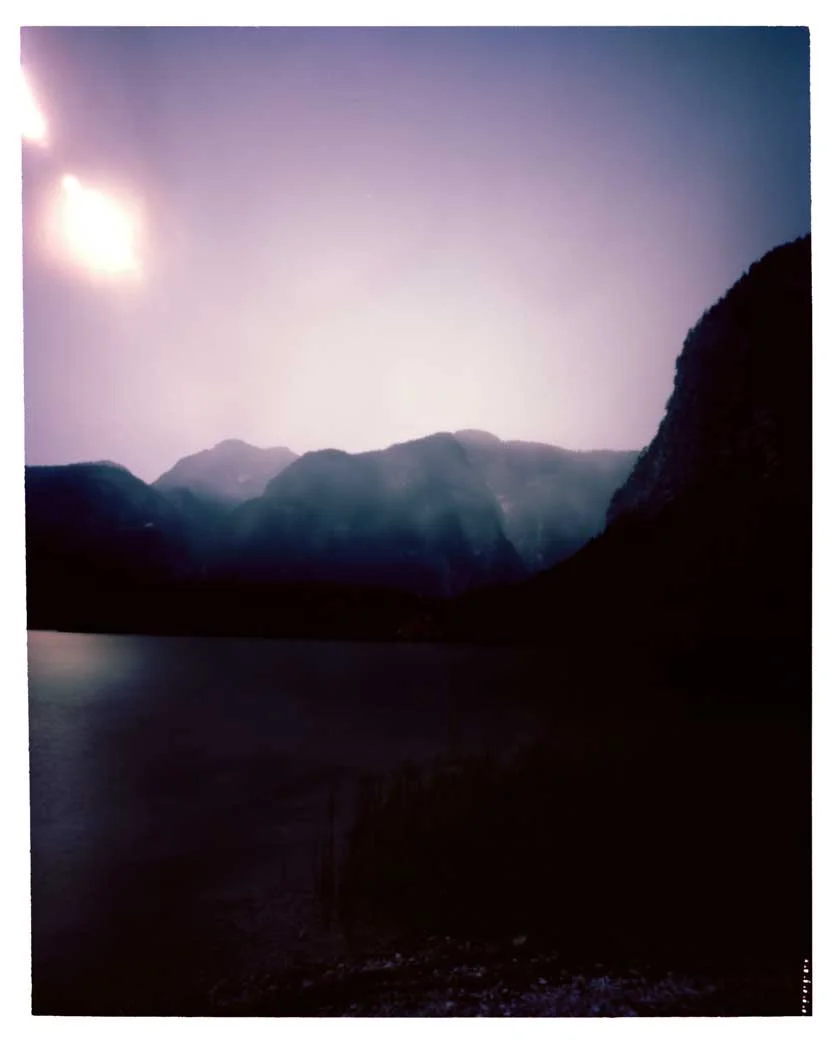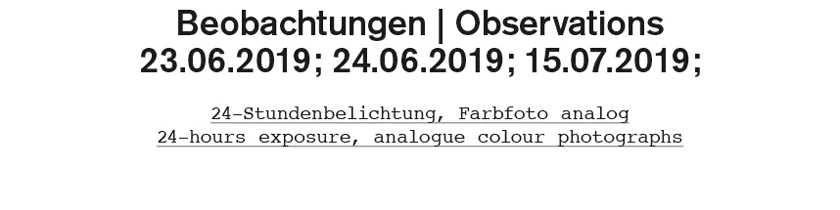- 2026
- minus20degree, Flachau /P
- 2025
- Transformator, Gedächtnis- & Transformationsraum | spominski & transformacijski prostor, Bad Eisenkappel | Železna Kapla /P
Drugi spomenik / The Other Monument, museum.kärnten, Klagenfurt /V
Paul Albert Leitner`s Photographic World, Camera Austria, Graz /D
2 Tonnen Kalkstein, Kunstraum Ideal, Leipzig (cat.) /G
Nach Anna Lülja Praun, S.I.X., Seewalchen /G
Hinschaun! / Poglejmo!, Kärnten Museum, Klagenfurt /G
Das menschliche und das tierische Wesen, Ursulinenkirche, Linz /E
Suburbia, Architekturzentrum Wien /D
Kardinal König Kunstpreis, Bildraum, Bregenz /G - 2024
- Ich muss mich erstmals sammeln!, HLMD - Hessisches
Landesmuseum Darmstadt /G
Kardinal König Kunstpreis, Lentos, Linz /G
Preise und Talente 2023, Kunstsammlung Oberösterreich, Linz /G
Kulturpreise des Landes Niederösterreich 2024, DOK NÖ Niederösterreichisches Dokumentationszentrum, St.Pölten /G
Neues aus der Sammlung, Kunstsammlung Oberösterreich, Linz /G
Steirische Fotobiennale, Altes Kino Leibnitz /G
Landschaft re_artikulieren, Museum Moderner Kunst Klagenfurt (cat.) /G
Schriftmuseum Pettenbach, Pettenbach /D
Über die Schwelle, Kunst und Kultur der Diözese Linz,
Hallstatt - Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut /G
NHM Biennale Klimatalk#1, Naturhistorisches Museum Wien,
Klima Biennale Vienna /V
Art&Function_Performance, Kunsthaus Mürz, Mürzzuschlag /G
Die Reise der Bilder, Lentos Linz – Kulturhauptstadt Bad Ischl
Salzkammergut (cat.) /G
Broncia Koller-Pinell, Belvedere, Vienna (cat.) /D
Gedenkort Reichenau Innsbruck, Kunst im öffentlichen Raum
(competition) /P
Täterätätää, Back with a Bang!, Kunsthalle Exnergasse, Vienna /G
Sudhaus. Kunst mit Salz und Wasser, Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut /G - 2023
- Observations, Collecting Norden, Worlding Northern Art (WONA) and Exploration, Exploitation and Exposition of the Gendered Heritage of the Arctic (XARC), Acadamy of Arts, Tromsø /V
Kyiv Biennale 2023, Vienna /G
Coincidence of Wants, Musa Wien Museum /G
graben/Landschaft/lesen-kopati/Grapo/brati,Bad Eisenkappel/Železna Kapla/G
Wer gedenkt der Partisaninnen und Partisanen? – Kdo se spominja partizank in partizanov?, Museum am Peršmanhof/Muzej Peršmanu, Železna Kapla /G
Labor und Bürogebäude an der Johannes Gutenberg Universität Mainz, Kunst im öffentlichen Raum (Wettbewerb) /P
Display und Ausstellungsraum, BIG ART, BIG, Vienna /D
LBS Holztechnikum Kuchl, Kunst im öffentlichen Raum (competition) /P
Künstler*innenbücher zu Gast: Nicole Six und Paul Petritsch,
Fotohof, Salzburg /E
Shared Space, Versuchsanstalt WUK Kunsthalle Exnergasse, Vienna /E
Edition Camera Austria (Hrsg. Reinhard Braun), Graz /D
@domplatz, Koroška/Kärnten gemeinsam Erinnern / skupno ohranimo spomin, Initiative Domplatz, Universität Klagenfurt /G - 2022
- Das Fest, MAK – Museum of Applied Arts, Vienna /G
Nach 2022 Jahren, Schlossmuseum, Linz /E
Koroška/Kärnten gemeinsam Erinnern / skupno ohranimo spomin, Initiative Domplatz, Kunst im öffentlichen Raum /P
Der Park, St.Agnes, Völkermarkt /G
Lueger Temporär, KÖR, Vienna /E
Inner Boarder, Pavelhaus | Pavlova Hiša, Radkersburg /G
Herbert Bayer, Lentos, Linz /D
Tableaux Vivants/Moving Stills, Architekturforum Zürich /G
Monumental Cares, University of Applied Arts, Vienna /V
XX Y X, Echoraum, Vienna /G
Rethinking Nature, Foto Wien /G - 2021
- Hungry for Time, Academy of Fine Arts Vienna /G
Retrospective Österreichischer Grafikwettbewerb, Taxispalais
Kunsthalle Tirol, Innsbruck /G
Notations, reflections & strategies of display, Contingent Agencies, Vienna /G
Later, gfk-Gesellschaft für Kulturpolitik OÖ, Linz /G
Rethinking Nature, Imago Lisboa, Lisboa /G
Tagung Block Beuys, Hessisches Landesmuseum Darmstadt (cat.) /D
Rethinking Nature, Casino Luxembourg - Forum d'art, Luxembourg /G
A Short History of Camera Traps, Fotograf Gallery, Prague /G
Gemeindezentrum Vöcklamarkt, Art in public space (competition) /P
Forming the Reformed, Academy of Fine Arts, Prague /V - 2020
- Der Angriff der Gegenwart, Universitätsgalerie Heiligenkreuzer Hof, Vienna (cat.) /G
Kärnten Koroška, von A-Ž, Landesgalerie Klagenfurt (cat.) /G
Nach uns die Sintflut, Kunst Haus Vienna (cat.) /G
Die Stadt & Das gute Leben, Camera Austria, Graz /G
Unplugged, Rudolfinum, Prague (cat.) /G
Carinthija, 2020, State Exhibition, Carinthia /G
Sexy Pages, Atelierhaus Hannover /G
Feuerstelle, lower austrian culture, art in public space , Klein-Meiseldorf /P
Fastentuch Vöcklamarkt, Diözesankonservatorat Linz /P
Die Nachbarn, Art in public space, Salzburg (competition) /P
Editionale Wien, University of Applied Arts, Vienna /G
The World to Come, DePaul Art Museum, Chicago (cat.) /G - 2019
- Ozeanische Gefühle, Hessisches Landesmuseum Darmstadt /E
Im Raum die Zeit lesen, mumok - Museum moderner Kunst
Stiftung Ludwig, Vienna /G
Vienna Art Book Fair #1, VABF with University of Applied Arts Vienna /G
Tag des Denkmals - Sea of Tranquility, The Pit, Breitenbrunn /V
Cinema of the Anthropocene, UNC-Wilmington, North Carolina /V
50 Jahre Mondlandung-10 Jahre Salzamt, Salzamt, Linz /G
ticket to the moon, Kunsthalle Krems (cat.) /G
Für die Vögel, lower austrian culture, art in public space /P
The World to Come, UMMA University Michigan Museum of Art (cat.) /G
Lentos-Außen, Linz (competition) /P
Klagenfurter Kunstfilmtage, Klagenfurt /V
Österreichbild, Architekturzentrum Vienna /P
Lassnig-Rainer, Lentos, Linz (cat.) /D - 2018
- Aufbruch ins Ungewisse – Österreich seit 1918,
Haus der Geschichte, Vienna /G
Lost and Found, T.R.A.M., Vienna/Bratislava (cat.) /P
In the case, haaaauch-quer, Klagenfurt /P
Das Denkmal, Museum und Gedenkstätte Peršmanhof, Železna Kapla /V
Rennes Ours, colophon, achevé d'imprimer : le livre d'artiste et le péritexte, Cabinet du Livre d'artiste, Agen, France /G
Project for the preservation of a tumulus, Großmugl, Lower Austria /P
Sommerfrische Reloaded 2018, S.I.X., Seewalchen /G
The World to Come, Harn Museum of Art, Florida (cat.) /G
Yesterday Today Today, Kunstraum Buchberg, Schloss Buchberg (cat.) /G
Garten der Künstler, Minoritenkloster, Tulln (cat.) /G
Post Otto Wagner, MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst, Vienna (cat.) /G
Das andere Land, Museum Moderner Kunst Klagenfurt (cat.) /G
1918- Klimt. Moser. Schiele. Gesammelte Schönheiten, Lentos, Linz /D
Auf die Plätze / Na mesta, Künstlerhaus Klagenfurt /G - 2017
- Floor, Wall, Body, Offspace-Night Vienna Art Week, Vienna /V
Grau in Grau – Ästhetisch Politische Praktiken der Erinnerungskultur,
Kunstuniversität Linz /V
Flüchtige Territorien, Kunstraum Niederösterreich, Vienna (cat.) /G
Uncommon Places, Goethe Institut, Hongkong /G
Mapping Terrains, Arccart, Vienna /G
Stretching the Boundaries, Fluca, Plovdiv /G
Kunst am Bau, Bruckner-Universität, Linz (competition) /P
Sterne. Kosmische Kunst, Lentos, Linz (cat.) /G
Un-Curating the Archive, Camera Austria, Graz /E
Unschärfen und weiße Flecken, Künsthaus Mürz (cat.) /G
AHEAD of the Game!, Künstlerhaus Klagenfurt /G - 2016
- Einrichtung, Camera Austria, Graz /D
Psst: there is still place in outer space!, Pavelhaus/Pavlova Hiša,
Radkersburg /G
Am Ende: Architektur, Architekturzentrum Vienna /D
Mahnmal für aktive Gewaltfreiheit, Linz (competition) /P
Herwig Turk Landschaft=Labor, Museum Moderner Kunst
Klagenfurt (cat.) /G
Ein stiller Begleiter, Großmugl /P
Seeing is believing, Museum Angerlehner, Wels (cat.) /G
SUPER J’arrive, Super Wien, Vienna /G - 2015
- Das Denkmal, Institut für Staatswissenschaften, Vienna /V
Filmbau. Schweizer Architektur im bewegten Bild, SAM Schweizerisches
Architekturmuseum, Basel (cat.) /G
Mehr als Zero, Hans Bischoffshausen, Österreichische Galerie Belvedere,
Vienna (cat.) /D
Fronteras En Cuestión II, Centro de Desarollo de las Artes Visuales,
Habana /G
Revers de Tromp, Academy of fine arts Vienna /G
Das Denkmal, Parallel Vienna, Vienna /G
Palm Capsule, Exposition Park, Los Angeles /P
Uncommon Places, Synthesis Gallery of Photography, Sofia /G
Fictitious Tales about the History of Earth, MAK Center, Los Angeles /G
Nicole Six & Paul Petritsch, Das Denkmal, Kunstraum Lakeside,
Klagenfurt /E
Mainzer Ansichten, Kunsthalle Mainz /E
The Visual Paradigm, Camera Austria, Graz /G
Vienna for Art`s Sake, Winter-Palast Belvedere, Vienna (cat.) /G - 2014
- Lichtblicke, Universitätskulturzentrum UNIKUM und section a, Trzic /G
Korrelation, Angewandte Innovation Laboratory, Vienna /G
Wirklichkeit und Konstruktion, Stadtgalerie Klagenfurt (cat.) /G
Die Gegenwart der Moderne, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig /V
Unframed, Galerie Raum mit Licht und Eikon, Vienna /G
Archives, Re-Assemblances and Surveys, On Austrian Contemporary
Photography, Klovicevi dvori Gallery, Zagreb (cat.) /G
Nicole Six und Paul Petritsch, Das Meer der Stille, Landesgalerie Linz (cat.) /E
Fade into You, Kunsthalle Mainz /V
MAK Design Labor, MAK – Österreichisches Museum für angewandte
Kunst, Vienna /G
Places of Transition, Freiraum – MuseumsQuartier Wien (cat.) /D - 2013
- Suicide Narcissus, The Renaissance Society, Chicago /G
Gefährdung, Entzug und grundloses Aushalten, Transmediale Kunst -
Universität für angewandte Kunst, Vienna /V
Vienna for Art`s Sake, Benetton Collection, Treviso (cat.) /G
Kunstgastgeber – Rennbahnweg 27, KÖR Kunst im öffentlichen Raum,
Vienna (Kat.) /P
Denkmal für die Verfolgten der NS-Miltärjustiz, Ballhausplatz 1010 Vienna /P
Nebelland hab ich gesehen, Museum Moderner Kunst Klagenfurt (cat.) /G
Is it really you, Kunstsammlung Oberösterreich, Linz /G
Praxis der Liebe, Salzburger Kunstverein, Salzburg /D
Das Bauhaus in Kalkutta, Bauhaus Dessau /D
Wolken, Welt des Flüchtigen, Leopold Museum, Vienna (cat.) /G
Schuss / Gegenschuss, in: Camera Austria, Nr. 121 /P - 2012
- Art is Concrete, Camera Austria, Graz /D
Sowjetmoderne, Architekturzentrum Vienna /D
Aus, Schluss Basta oder Wir sind total am Ende, Schauspielhaus Graz /V
Keine Zeit, erschöpftes Selbst / entgrenzetes Können, 21er Haus,
Vienna (cat.) /G
Space Affairs, Musa, Vienna /G
Aussicht kann durch Ladung verstellt sein, Kunstverein Medienturm,
Graz (cat.) /E - 2011
- Im täglichen Wahnsinn den Zauber finden!, Kunstraum Goethestrasse
xtd, Linz /G
Schall und Rauch, die Vertikale und der freie Fall, TransArts - Universität
für angewandte Kunst, Vienna /V
If a tree falls in the forest, and nobody hears it, does it make a sound?,
Galerie Lisa Ruyter, Vienna /G
Das Ding an sich, Mariendom, Linz /P
Raum für 17 Minuten 6’23’’, Galerie im Taxispalais, Innsbruck (cat.) /E
Prima Interventionen, Atelierhaus Salzamt, Linz /G
Proposals for Venice, Landesgalerie Linz (cat.) /G - 2010
- Körper Codes, Museum der Moderne Salzburg /G
Der Aufstand der Zeichen, k48, Vienna, Intervention im öffentlichen Raum /P
Heimat/Domovina, Museum Moderner Kunst Klagenfurt (cat.) /G
Triennale Linz 1.0, Linz (cat.) /G
Blind Date, Kunstverein Hannover /E
Atlas, Secession, Vienna (cat.) /E
Upon Arrival, Malta Contemporary Art, Malta (cat.) /G - 2009
- Österreichischer Grafikwettbewerb (31), Galerie im Taxispalais,
Innsbruck (cat.) /G
Mahnmal für die Zwangsarbeitslager St. Pölten - Viehofen,
in Zusammenarbeit mit Jeanette Pacher (nicht realisiert) /P
Das menschliche und das tierische Wesen, Ursulinenkirche, Linz /E
Reading the City, ev+a 2009, Limerick (cat.) /G
Spotlight, Museum der Moderne, Salzburg /G - 2008
- Undiszipliniert, Das Phänomen Raum in Kunst, Architektur und Design, Kunsthalle Exnergasse, Vienna (cat.) /G
Peter Zumthor, Bauten und Projekte 1986–2007 mit einer Filminstallation von Nicole Six & Paul Petritsch, Experimentadesign, Lissabon /P
zu Gironcoli, Gironcoli Museum, Herberstein /G
K08, Emanzipation und Konfrontation, Künstlerhaus Klagenfurt (cat.) /G
Was ist ein Platz? Was ist ein Cy-BORG-Platz?, Temporäre Kunst im Stadtraum, Wiener Neustadt /P
unterwegs sein, Kunstraum Düsseldorf (cat.) /G
Bildpolitiken, Salzburger Kunstverein, Salzburg /D
Kontakt...aus der Sammlung der Erste Bank-Gruppe, Institut
of Contemporary Art, Dunaújváros /D
zoom and scale, Akademie der bildenden Künste, Vienna /G - 2007
- Max Ernst und die Welt im Buch, Museum der Moderne, Salzburg /G
Peter Zumthor, Bauten und Projekte 1986–2007 mit einer Filminstallation von Nicole Six & Paul Petritsch, KUB Kunsthaus Bregenz /P
Temporally, The Israeli Center for Digital Art, Holon /G
Margherita Spiluttini. Atlas Austria, Architekturzentrum Vienna /D
Kunstverein Baden, Kunstverein Baden /G
Blickwechsel Nr.3, MMKK, Klagenfurt (cat.) /G
I`m too tired to tell you, Agentur, Amsterdam /E
Film ab, Universität für Musik und darstellende Kunst, BIG, Vienna /P
Kontakt Belgrad...aus der Sammlung der Erste Bank-Gruppe, Museum Moderner Kunst, Belgrad /D - 2006
- Longitude / Latitude, haaaauch, Klagenfurt /E
Nicole Six / Paul Petritsch, Gesellschaft für aktuelle Kunst, Bremen /E
First the artist defines meaning, Camera Austria, Graz /G
Société des nations, Circuit, Lausanne /G
How and Wow, Experimentelle Gestaltung Kunstuniversität Linz, Linz /V
Kontakt...aus der Sammlung der Erste Bank-Gruppe, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Vienna /D
Margherita Spiluttini. Atlas Austria, Architekturzentrum Wien mit Arco, Madrid /D - 2005
- Tu Felix Austria…Wild at Heart, KUB Kunsthaus Bregenz (cat.) /G
Home Stories, Architekturzentrum Wien mit Austrian Cultural Forum,
New York /D
Das Spannende ist doch die Organisation von Materie, Area 53, Vienna /G
Wisdom of Nature, Nagoya City Art Museum, Nagoya (cat.) /G
Das Neue 2, Atelier im Augarten, Zentrum für zeitgenössische Kunst der Österreichischen Galerie Belvedere, Vienna (cat.) /G
Großmugl, Wettbewerb Kunst im öffentlichen Raum, Großmugl
(unrealized) /P
Museums-Empfangsbereich, Frac Lorraine, Metz, Frankreich /P
Slices of Life, blueprints of the self in painting, Austrian Cultural Forum,
New York /D - 2004
- Open Studio, ISCP, New York /G
Transgressing-Systems, Ausstellen zu Bauen und Kunst, Innsbruck /G
1.33.33, Area 53, Wien /G
Permanent Produktiv, Kunsthalle Exnergasse, Vienna /G
White Spirit in Public Spaces, F.R.A.C. de Lorrain, Metz /G
The Austrian Phenomenon / Konzepte Experimente Wien Graz 1958-1973, Architekturzentrum Vienna /D - 2003
- Fata Morgana, Wettbewerb Silos Graz-West, Kulturhauptstadt Graz 2003
in collaboration with Jeanette Pacher (unrealized) /P
Flutlichtmast, Wettbewerb Kunst im öffentlichen Raum in Rohrendorf
in collaboration with Hans Schabus (unrealized) /P
Trauer, Atelier im Augarten, Zentrum für zeitgenössische Kunst der Österreichischen Galerie Belvedere, Vienna (cat.) /G
America, bgf_plattform, Berlin /G
Extended Architecture, Tanzwerkstatt Europa, Neues Theater, München /G
just build it! Die Bauten des Rural Studio, Architekturzentrum Vienna /D
site-seeing: disneyfizierung der städte, Künstlerhaus Vienna /D - 2002
- artists´choice, CAT Contemporary Art Tower – MAK
Gegenwartskunstdepot, Vienna /E
space off, supersaat, Vienna /G - 2001
- moving out, Universität für angewandte Kunst, Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Vienna /D
/E Solo Exhibition
/G Group Exhibition
/P Projects: Interventions, Public Space, Competition or realized Projects
/D Display: Exhibition, Catalogs
/V Lecture and Screenings, Presentations
- 2026
- minus20degree, Flachau /P
- 2025
- Transformator, Gedächtnis- & Transformationsraum | spominski & transformacijski prostor, Bad Eisenkappel | Železna Kapla /P
Drugi spomenik / Das andere Denkmal, museum.kärnten, Klagenfurt /V
Paul Albert Leitner`s Photographic World, Camera Austria, Graz /D
2 Tonnen Kalkstein, Kunstraum Ideal, Leipzig (Katalog) /G
Nach Anna Lülja Praun, S.I.X., Seewalchen /G
Hinschaun! / Poglejmo!, Kärnten Museum, Klagenfurt /G
Das menschliche und das tierische Wesen, Ursulinenkirche, Linz /E
Suburbia, Architekturzentrum Wien /D
Kardinal König Kunstpreis, Bildraum, Bregenz /G - 2024
- Ich muss mich erstmals sammeln!, HLMD - Hessisches
Landesmuseum Darmstadt /G
Kardinal König Kunstpreis, Lentos, Linz /G
Preise und Talente 2023, Kunstsammlung Oberösterreich, Linz /G
Kulturpreise des Landes Niederösterreich 2024, DOK NÖ Niederösterreichisches Dokumentationszentrum, St.Pölten /G
Neues aus der Sammlung, Kunstsammlung Oberösterreich, Linz /G
Steirische Fotobiennale, Altes Kino Leibnitz /G
Landschaft re_artikulieren, Museum Moderner Kunst Klagenfurt (Katalog) /G
Schriftmuseum Pettenbach, Pettenbach /D
Über die Schwelle, Kunst und Kultur der Diözese Linz,
Hallstatt - Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut /G
NHM Biennale Klimatalk#1, Naturhistorisches Museum Wien,
Klima Biennale Wien /V
Art&Function_Performance, Kunsthaus Mürz, Mürzzuschlag /G
Die Reise der Bilder, Lentos – Kulturhauptstadt Bad Ischl
Salzkammergut (Katalog) /G
Broncia Koller-Pinell, Belvedere, Wien (Katalog) /D
Gedenkort Reichenau Innsbruck, Kunst im öffentlichen Raum
(Wettbewerb) /P
Täterätätää, Back with a Bang!, Kunsthalle Exnergasse, Wien /G
Sudhaus. Kunst mit Salz und Wasser, Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut /G - 2023
- Observations, Collecting Norden, Worlding Northern Art (WONA) and Exploration, Exploitation and Exposition of the Gendered Heritage of the Arctic (XARC), Acadamy of Arts, Tromsø /V
Kyiv Biennale 2023, Wien /G
Coincidence of Wants, Musa Wien Museum /G
graben/Landschaft/lesen-kopati/Grapo/brati,Bad Eisenkappel/Železna Kapla/G
Wer gedenkt der Partisaninnen und Partisanen? – Kdo se spominja partizank in partizanov?, Museum am Peršmanhof/Muzej Peršmanu, Železna Kapla /G
Labor und Bürogebäude an der Johannes Gutenberg Universität Mainz, Kunst im öffentlichen Raum (Wettbewerb) /P
Display und Ausstellungsraum, BIG ART, BIG, Wien /D
LBS Holztechnikum Kuchl, Kunst im öffentlichen Raum (Wettbewerb) /P
Künstler*innenbücher zu Gast: Nicole Six und Paul Petritsch,
Fotohof, Salzburg /E
Shared Space, Versuchsanstalt WUK Kunsthalle Exnergasse, Wien /E
Edition Camera Austria (Hrsg. Reinhard Braun), Graz /D
@domplatz, Koroška/Kärnten gemeinsam Erinnern / skupno ohranimo spomin, Initiative Domplatz, Universität Klagenfurt /G - 2022
- Das Fest, MAK – Museum für Angewandte Kunst, Wien /G
Nach 2022 Jahren, Schlossmuseum, Linz /E
Koroška/Kärnten gemeinsam Erinnern / skupno ohranimo spomin, Initiative Domplatz, Kunst im öffentlichen Raum /P
Der Park, St.Agnes, Völkermarkt /G
Lueger Temporär, KÖR, Wien /E
Inner Boarder, Pavelhaus | Pavlova Hiša, Radkersburg /G
Herbert Bayer, Lentos, Linz /D
Tableaux Vivants/Moving Stills, Architekturforum Zürich /G
Monumental Cares, Universität für angewandte Kunst, Wien /V
XX Y X, Echoraum, Wien /G
Rethinking Nature, Foto Wien /G - 2021
- Hungry for Time, Akademie der bildenden Künste Wien /G
Retrospective Österreichischer Grafikwettbewerb, Taxispalais
Kunsthalle Tirol, Innsbruck /G
Notations, reflections & strategies of display, Contingent Agencies, Wien /G
Later, gfk-Gesellschaft für Kulturpolitik OÖ, Linz /G
Rethinking Nature, Imago Lisboa, Lissabon /G
Tagung Block Beuys, Hessisches Landesmuseum Darmstadt (Kat.) /D
Rethinking Nature, Casino Luxembourg - Forum d'art, Luxembourg /G
A Short History of Camera Traps, Fotograf Gallery, Prag /G
Gemeindezentrum Vöcklamarkt, Kunst im öffentlichen Raum
(Wettbewerb) /P
Forming the Reformed, Akademie der Bildenden Künste Prag /V - 2020
- Der Angriff der Gegenwart, Universitätsgalerie Heiligenkreuzer Hof, Wien (Kat.) /G
Kärnten Koroška, von A-Ž, Landesgalerie Klagenfurt (Kat.) /G
Nach uns die Sintflut, Kunst Haus Wien (Kat.) /G
Die Stadt & Das gute Leben, Camera Austria, Graz /G
Unplugged, Rudolfinum, Prag (Kat.) /G
Carinthija, 2020, Landesausstellung, Kärnten /G
Sexy Pages, Atelierhaus Hannover /G
Feuerstelle, Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich, Klein-Meiseldorf /P
Fastentuch Vöcklamarkt, Diözesankonservatorat Linz /P
Die Nachbarn, Kunst im öffentlichen Raum Salzburg (Wettbewerb) /P
Editionale Wien, Universität für angewandte Kunst, Wien /G
The World to Come, DePaul Art Museum, Chicago (Kat.) /G - 2019
- Ozeanische Gefühle, Hessisches Landesmuseum Darmstadt /E
Im Raum die Zeit lesen, Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wien /G
Vienna Art Book Fair #1, VABF+Universität für angewandte Kunst Wien /G
Tag des Denkmals - Sea of Tranquility, The Pit, Breitenbrunn /V
Cinema of the Anthropocene, UNC-Wilmington, North Carolina /V
50 Jahre Mondlandung-10 Jahre Salzamt, Salzamt, Linz /G
ticket to the moon, Kunsthalle Krems (Kat.) /G
Für die Vögel, Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich /P
The World to Come, UMMA University Michigan Museum of Art (Kat.) /G
Lentos-Außen, Linz (Wettbewerb) /P
Klagenfurter Kunstfilmtage, Klagenfurt /V
Österreichbild, Architekturzentrum Wien /P
Lassnig-Rainer, Lentos, Linz (Kat.) /D - 2018
- Aufbruch ins Ungewisse – Österreich seit 1918,
Haus der Geschichte, Wien /G
Lost and Found, T.R.A.M., Wien/Bratislava (Kat.) /P
In the case, haaaauch-quer, Klagenfurt /P
Das Denkmal, Museum und Gedenkstätte Peršmanhof, Železna Kapla /V
Rennes Ours, colophon, achevé d'imprimer : le livre d'artiste et le péritexte, Cabinet du Livre d'artiste, Agen, Frankreich /G
Projekt zum Schutz eines Hügelgrabs, Großmugl, Niederösterreich /P
Sommerfrische Reloaded 2018, S.I.X., Seewalchen /G
The World to Come, Harn Museum of Art, Florida (Kat.) /G
Yesterday Today Today, Kunstraum Buchberg, Schloss Buchberg (Kat.) /G
Garten der Künstler, Minoritenkloster, Tulln (Kat.) /G
Post Otto Wagner, MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst, Wien (Kat.) /G
Das andere Land, Museum Moderner Kunst Klagenfurt (Kat.) /G
1918- Klimt. Moser. Schiele. Gesammelte Schönheiten, Lentos, Linz /D
Auf die Plätze / Na mesta, Künstlerhaus Klagenfurt /G - 2017
- Floor, Wall, Body, Offspace-Night Vienna Art Week, Wien /V
Grau in Grau – Ästhetisch Politische Praktiken der Erinnerungskultur,
Kunstuniversität Linz /V
Flüchtige Territorien, Kunstraum Niederösterreich, Wien (Kat.) /G
Uncommon Places, Goethe Institut, Hongkong /G
Mapping Terrains, Arccart, Wien /G
Stretching the Boundaries, Fluca, Plovdiv /G
Kunst am Bau, Bruckner-Universität, Linz (Wettbewerb) /P
Sterne. Kosmische Kunst, Lentos, Linz (Kat.) /G
Un-Curating the Archive, Camera Austria, Graz /E
Unschärfen und weiße Flecken, Künsthaus Mürz (Kat.) /G
AHEAD of the Game!, Künstlerhaus Klagenfurt /G - 2016
- Einrichtung,, Camera Austria, Graz /D
Psst: there is still place in outer space!, Pavelhaus/Pavlova Hiša,
Radkersburg /G
Am Ende: Architektur, Architekturzentrum Wien /D
Mahnmal für aktive Gewaltfreiheit, Linz (Wettbewerb) /P
Herwig Turk Landschaft=Labor, Museum Moderner Kunst
Klagenfurt (Kat.) /G
Ein stiller Begleiter, Großmugl /P
Seeing is believing, Museum Angerlehner, Wels (Kat.) /G
SUPER J’arrive, Super Wien /G - 2015
- Das Denkmal, Institut für Staatswissenschaften, Wien /V
Filmbau. Schweizer Architektur im bewegten Bild, SAM Schweizerisches
Architekturmuseum, Basel (Kat.) /G
Mehr als Zero, Hans Bischoffshausen, Österreichische Galerie Belvedere,
Wien (Kat.) /D
Fronteras En Cuestión II, Centro de Desarollo de las Artes Visuales,
Habana /G
Revers de Tromp, Akademie der bildenden Künste Wien /G
Das Denkmal, Parallel Vienna, Wien /G
Palm Capsule, Exposition Park, Los Angeles /P
Uncommon Places, Synthesis Gallery of Photography, Sofia /G
Fictitious Tales about the History of Earth, MAK Center, Los Angeles /G
Nicole Six & Paul Petritsch, Das Denkmal, Kunstraum Lakeside,
Klagenfurt /E
Mainzer Ansichten, Kunsthalle Mainz /E
The Visual Paradigm, Camera Austria, Graz /G
Vienna for Art`s Sake, Winter-Palast Belvedere, Wien (Kat.) /G - 2014
- Lichtblicke, Universitätskulturzentrum UNIKUM und section a, Trzic /G
Korrelation, Angewandte Innovation Laboratory, Wien /G
Wirklichkeit und Konstruktion, Stadtgalerie Klagenfurt (Kat.) /G
Die Gegenwart der Moderne, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig /V
Unframed, Galerie Raum mit Licht und Eikon, Wien /G
Archives, Re-Assemblances and Surveys, On Austrian Contemporary
Photography, Klovicevi dvori Gallery, Zagreb (Kat.) /G
Nicole Six und Paul Petritsch, Das Meer der Stille, Landesgalerie Linz (Kat.) /E
Fade into You, Kunsthalle Mainz /V
MAK Design Labor, MAK – Österreichisches Museum für angewandte
Kunst, Wien /G
Places of Transition, Freiraum – MuseumsQuartier Wien (Kat.) /D - 2013
- Suicide Narcissus, The Renaissance Society, Chicago /G
Gefährdung, Entzug und grundloses Aushalten, Transmediale Kunst -
Universität für angewandte Kunst, Wien /V
Vienna for Art`s Sake, Benetton Collection, Treviso (Kat.) /G
Kunstgastgeber – Rennbahnweg 27, KÖR Kunst im öffentlichen Raum,
Wien (Kat.) /P
Denkmal für die Verfolgten der NS-Miltärjustiz, Ballhausplatz 1010 Wien /P
Nebelland hab ich gesehen, Museum Moderner Kunst Klagenfurt (Kat.) /G
Is it really you, Kunstsammlung Oberösterreich, Linz /G
Praxis der Liebe, Salzburger Kunstverein, Salzburg /D
Das Bauhaus in Kalkutta, Bauhaus Dessau /D
Wolken, Welt des Flüchtigen, Leopold Museum, Wien (Kat.) /G
Schuss / Gegenschuss, in: Camera Austria, Nr. 121 /P - 2012
- Art is Concrete, Camera Austria, Graz /D
Sowjetmoderne, Architekturzentrum Wien /D
Aus, Schluss Basta oder Wir sind total am Ende, Schauspielhaus Graz /V
Keine Zeit, erschöpftes Selbst / entgrenzetes Können, 21er Haus,
Wien (Kat.) /G
Space Affairs, Musa, Wien /G
Aussicht kann durch Ladung verstellt sein, Kunstverein Medienturm,
Graz (Kat.) /E - 2011
- Im täglichen Wahnsinn den Zauber finden!, Kunstraum Goethestrasse
xtd, Linz /G
Schall und Rauch, die Vertikale und der freie Fall, TransArts - Universität
für angewandte Kunst, Wien /V
If a tree falls in the forest, and nobody hears it, does it make a sound?,
Galerie Lisa Ruyter, Wien /G
Das Ding an sich, Mariendom, Linz /P
Raum für 17 Minuten 6’23’’, Galerie im Taxispalais, Innsbruck (Kat.) /E
Prima Interventionen, Atelierhaus Salzamt, Linz /G
Proposals for Venice, Landesgalerie Linz (Kat.) /G - 2010
- Körper Codes, Museum der Moderne Salzburg /G
Der Aufstand der Zeichen, k48, Wien, Intervention im öffentlichen Raum /P
Heimat/Domovina, Museum Moderner Kunst Klagenfurt (Kat.) /G
Triennale Linz 1.0, Linz (Kat.) /G
Blind Date, Kunstverein Hannover /E
Atlas, Secession, Wien (Kat.) /E
Upon Arrival, Malta Contemporary Art, Malta (Kat.) /G - 2009
- Österreichischer Grafikwettbewerb (31) , Galerie im Taxispalais,
Innsbruck (Kat.) /G
Mahnmal für die Zwangsarbeitslager St. Pölten - Viehofen,
in Zusammenarbeit mit Jeanette Pacher (nicht realisiert) /P
Das menschliche und das tierische Wesen, Ursulinenkirche, Linz /E
Reading the City, ev+a 2009, Limerick (Kat.) /G
Spotlight, Museum der Moderne, Salzburg /G - 2008
- Undiszipliniert, Das Phänomen Raum in Kunst, Architektur und Design, Kunsthalle Exnergasse, Wien (Kat.) /G
Peter Zumthor, Bauten und Projekte 1986–2007 mit einer Filminstallation von Nicole Six & Paul Petritsch, Experimentadesign, Lissabon /P
zu Gironcoli, Gironcoli Museum, Herberstein /G
K08, Emanzipation und Konfrontation, Künstlerhaus Klagenfurt (Kat.) /G
Was ist ein Platz? Was ist ein Cy-BORG-Platz?, Temporäre Kunst im Stadtraum, Wiener Neustadt /P
unterwegs sein, Kunstraum Düsseldorf (Kat.) /G
Bildpolitiken, Salzburger Kunstverein, Salzburg /D
Kontakt...aus der Sammlung der Erste Bank-Gruppe, Institut
of Contemporary Art, Dunaújváros (Display) /D
zoom and scale, Akademie der bildenden Künste, Wien /G - 2007
- Max Ernst und die Welt im Buch, Museum der Moderne, Salzburg /G
Peter Zumthor, Bauten und Projekte 1986–2007 mit einer Filminstallation von Nicole Six & Paul Petritsch, KUB Kunsthaus Bregenz /P
Temporally, The Israeli Center for Digital Art, Holon /G
Margherita Spiluttini. Atlas Austria, Architekturzentrum Wien /D
Kunstverein Baden, Kunstverein Baden /G
Blickwechsel Nr.3, MMKK, Klagenfurt (Kat.) /G
I`m too tired to tell you, Agentur, Amsterdam /E
Film ab, Universität für Musik und darstellende Kunst, BIG, Wien /P
Kontakt Belgrad...aus der Sammlung der Erste Bank-Gruppe, Museum Moderner Kunst, Belgrad /D - 2006
- Longitude / Latitude, haaaauch, Klagenfurt /E
Nicole Six / Paul Petritsch, Gesellschaft für aktuelle Kunst, Bremen /E
First the artist defines meaning, Camera Austria, Graz /G
Société des nations, Circuit, Lausanne /G
How and Wow, Experimentelle Gestaltung Kunstuniversität Linz, Linz /V
Kontakt...aus der Sammlung der Erste Bank-Gruppe, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wien /D
Margherita Spiluttini. Atlas Austria, Architekturzentrum Wien mit Arco, Madrid /D - 2005
- Tu Felix Austria…Wild at Heart, KUB Kunsthaus Bregenz (Kat.) /G
Home Stories, Architekturzentrum Wien mit Austrian Cultural Forum,
New York /D
Das Spannende ist doch die Organisation von Materie, Area 53, Wien /G
Wisdom of Nature, Nagoya City Art Museum, Nagoya (Kat.) /G
Das Neue 2, Atelier im Augarten, Zentrum für zeitgenössische Kunst der Österreichischen Galerie Belvedere, Wien (Kat.) /G
Großmugl, Wettbewerb Kunst im öffentlichen Raum, Großmugl
(nicht realisiert) /P
Museums-Empfangsbereich, Frac Lorraine, Metz, Frankreich /P
Slices of Life, blueprints of the self in painting, Austrian Cultural Forum,
New York /D - 2004
- Open Studio, ISCP, New York /G
Transgressing-Systems, Ausstellen zu Bauen und Kunst, Innsbruck /G
1.33.33, Area 53, Wien /G
Permanent Produktiv, Kunsthalle Exnergasse, Wien /G
White Spirit in Public Spaces, F.R.A.C. de Lorrain, Metz /G
The Austrian Phenomenon / Konzepte Experimente Wien Graz 1958-1973, Architekturzentrum Wien /D - 2003
- Fata Morgana, Wettbewerb Silos Graz-West, Kulturhauptstadt Graz 2003
in Zusammenarbeit mit Jeanette Pacher (nicht realisiert) /P
Flutlichtmast, Wettbewerb Kunst im öffentlichen Raum in Rohrendorf
in Zusammenarbeit mit Hans Schabus (nicht realisiert) /P
Trauer, Atelier im Augarten, Zentrum für zeitgenössische Kunst der Österreichischen Galerie Belvedere, Wien (Kat.) /G
America, bgf_plattform, Berlin /G
Extended Architecture, Tanzwerkstatt Europa, Neues Theater, München /G
just build it! Die Bauten des Rural Studio, Architekturzentrum Wien /D
site-seeing: disneyfizierung der städte, Künstlerhaus Wien /D - 2002
- artists´choice, CAT Contemporary Art Tower – MAK
Gegenwartskunstdepot, Wien /E
space off, supersaat, Wien /G - 2001
- moving out, Universität für angewandte Kunst, Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien /D
/E Einzelausstellungen
/G Gruppenausstellungen
/P Projekte: Intervention, öffentlicher Raum, Wettbewerbe oder realisiert Projekte
/D Display: Ausstellungen, Katalog
/V Vorträge u. Screening, Präsentation
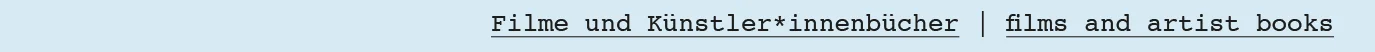
FILMS
- 2025
- Drugi spomenik / Das andere Denkmal
Video with sound
one-channel projection
32 min 22 sec, colour - 2024
- Seemeile (Sumbu und Pekel)
Video with sound
one-channel projection
20 min 49 sec, colour
Die Reise der Bilder
Video with sound
eight-channel projection
24 min 24 sec - 33min 23 sec, colour - 2023
- Lueger Temporär
Video with sound
one-channel projection
22 min 11 sec, colour
05.01.2023 (Pečnikov travnik/Pečnik-Wiese)
Video with sound
four-channel projection
1h 50min, colour - 2021
- Pilot
(Dialogisch den Horizont expandieren - von Klagenfurt nach Klagenfurt)
Video with sound
one-channel projection
11 min 08 sec, colour
Roxy, 27.05.2021 (Block Beuys)
Video with sound
one-channel projection
8 min 12 sec, colour - 2020
- Parallel Worlds
20.03.2020 / 01.04.2020 / 20.04.2020
Video with sound
three-channel projection
23 min 12sec, colour - 2017
- Ohne Titel (Albaner Hafen)
Video with sound
three-channel projection
51 min, colour - 2015
- Das Denkmal
Video with sound
two-channel projection
130 min, colour - 2014
- Raum für 5’16’’
Video with sound
two-channel projection
5 min 16 sec, colour
Das Meer der Stille
Video with sound on DVD
3 min 34 sec, colour - 2011
- Raum für 17 Minuten 6’23’’
Video with sound
two-channel projection
6 min 23 sec, colour - 2009
- Das menschliche und das tierische Wesen
Video with sound
five-channel projection
19 min, colour - 2007
- Ohne Titel, twelve buildings by Peter Zumthor
Video with sound
six-channel projection
480 min, colour
Nebel
Video with sound on DVD
30 min, colour - 2005
- Ohne Titel, Kunsthaus Bregenz
Video with sound on DVD
six-channel projection
72 h, colour
I’m too tired to tell you
Video on DVD
17 min, colour, silent - 2004
- Longitude / Latitude
Video on DVD
77 min, colour, silent
Raum
Video with sound on DVD
60 min, colour - 2003
- Camera dead
Video with sound on DVD
35 sec, colour
Räumliche Maßnahme (2)
Video with sound on DVD
two-channel projection
50 min, colour - 2002
- Räumliche Maßnahme (1)
Video with sound on DVD
28 min, colour
ARTISTS BOOKS (EDITIONS)
- 2025
- 2 Tonnen Kalkstein
Kunstraum IDEAL (Hg.)
Edition: 5
Archiv-Lesebuch (ChatGPT)
Kunstraum IDEAL (Hg.)
Edition: 5
Drugi Spomenik / Das andere Denkmal
Nicole Six und Paul Petritsch mit Jakob Holzer (Hg.), Wien
unlimitiert - 2021
- Roxy, 27.05.2021 (Block Beuys)
Hessisches Landesmuseum Darmstadt (Hg.),
Edition: 10+2 - 2020
- Unplugged
David Korecky, Galerie Rudolfinum (eds.), Prague
Edition: 99 - 2018
- Lost and Found
Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna
Edition: 8+2 - 2016
- Fotoarchiv 30.06.2016-26.04.2015
Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna
Edition: 20+2 - 2015
- Fotoarchiv 26.04.2015-06.05.2014
Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna
Edition: 20+2 - 2014
- Das Meer der Stille
Landesgalerie Linz / Barbara Schröder (eds.), Linz
Fotoarchiv 14.04.2014-10.07.2012
Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna
Edition: 20+2 - 2012
- Aussicht kann durch Ladung verstellt sein
Kunstverein Medienturm (eds.), Graz
Edition: 20+2
Fotoarchiv 20.04.2012-09.03.2010
Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna
Edition: 20+2 - 2011
- Raum für 17 Minuten 6’23
Galerie im Taxispalais (eds.), Innsbruck - 2010
- Atlas
Nicole Six und Paul Petritsch, Secession (eds.), Vienna
Edition: 20+2
Fotoarchiv 20.02.2010-17.10.2009
Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna
Edition: 20+2
Innere Grenze
Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna
Edition: 3+2 - 2009
- Fotoarchiv 28.09.2009-7.10.2008
Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna
Edition: 20+2 - 2008
- Fotoarchiv 05.10.2008-16.02.2007
Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna
Edition: 20+2 - 2007
- Fotoarchiv 21.01.2007-07.09.2005
Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna
Edition: 20+2 - 2005
- Fotoarchiv 16.08.2005-04.08.2004
Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna
Edition: 20+2 - 2004
- Fotoarchiv 06.06.2004-15.02.2001
Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna
Edition: 20+2
Raumbuch
Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna
Edition: 3+2
FILME
- 2025
- Drugi spomenik / Das andere Denkmal
Video, 1 Kanal
32 min 22 sec
Ton, Farbe - 2024
- Seemeile (Sumbu und Pekel)
Video, 1 Kanal
20 min 49 sec
Ton, Farbe
Die Reise der Bilder
Video, 8 Kanal
24 min 24 sec - 33min 23 sec, Ton, Farbe - 2023
- Lueger Temporär
Video, 1 Kanal
22 min 11 sec, Ton, Farbe
05.01.2023 (Pečnikov travnik/Pečnik-Wiese)
Video, 4 Kanal
1h 50min, Ton, Farbe - 2021
- Pilot
(Dialogisch den Horizont expandieren
- von Klagenfurt nach Klagenfurt)
Video, 1 Kanal
11 min 08 sec, Ton, Farbe
Roxy, 27.05.2021 (Block Beuys)
Video, 1 Kanal
8 min 12 sec, Ton, Farbe - 2020
- Parallel Worlds
20.03.2020 / 01.04.2020 / 20.04.2020
Video, 3 Kanal
23 min 12sec, Ton, Farbe - 2017
- Ohne Titel (Albaner Hafen)
Video
3 Kanal Projektion
51 min, Farbe, Ton - 2015
- Das Denkmal
Video
2 Kanal Projektion
130 min, Farbe, Ton - 2014
- Raum für 5’16’’
Video
2 Kanal Projektion
5 min 16 sec, Farbe, Ton
Das Meer der Stille
Video
3 min 34 sec, Farbe, Ton - 2011
- Raum für 17 Minuten 6’23’’
Video
2 Kanal Projektion
6 min 23 sec, Farbe, Ton - 2009
- Das menschliche und das tierische Wesen
Video
5 Kanal Projektion
19 min, Farbe, Ton - 2007
- Ohne Titel, 12 Bauten von Peter Zumthor
Video
6 Kanal Projektion
480 min, Farbe, Ton
Nebel
Video auf DVD
30 min, Farbe, Ton - 2005
- Ohne Titel, Kunsthaus Bregenz
Video auf DVD
6 Kanal Projektion
72 h, Farbe, Ton
I’m too tired to tell you
Video auf DVD
17 min, Farbe, ohne Ton - 2004
- Longitude / Latitude
Video auf DVD
77 min, Farbe, ohne Ton
Raum
Video auf DVD
60 min, Farbe, Ton - 2003
- Camera dead
Video auf DVD
35 sec, Farbe, Ton
Räumliche Maßnahme (2)
Video auf DVD
2 Kanal Projektion
50 min, Farbe, Ton - 2002
- Räumliche Maßnahme (1)
Video auf DVD
28 min, Farbe, Ton
ARTISTS BOOKS (EDITIONS)
- 2025
- 2 Tonnen Kalkstein
Kunstraum IDEAL (Hg.)
Edition: 5
Archiv-Lesebuch (ChatGPT)
Kunstraum IDEAL (Hg.)
Edition: 5
Drugi Spomenik / Das andere Denkmal
Nicole Six und Paul Petritsch mit Jakob Holzer (Hg.), Wien
unlimitiert - 2021
- Roxy, 27.05.2021 (Block Beuys)
Hessisches Landesmuseum Darmstadt (Hg.),
Edition: 10+2 - 2020
- Unplugged
David Korecky, Galerie Rudolfinum (Hg.), Prag
Edition: 99 - 2018
- Lost and Found
Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien
Edition: 8+2 - 2016
- Fotoarchiv 30.06.2016-26.04.2015
Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien
Edition: 20+2 - 2015
- Fotoarchiv 26.04.2015-06.05.2014
Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien
Edition: 20+2 - 2014
- Das Meer der Stille
Landesgalerie Linz / Barbara Schröder (Hg.), Linz
Fotoarchiv 14.04.2014-10.07.2012
Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien
Edition: 20+2 - 2012
- Aussicht kann durch Ladung verstellt sein
Kunstverein Medienturm (Hg.), Graz
Edition: 20+2
Fotoarchiv 20.04.2012-09.03.2010
Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien
Edition: 20+2 - 2011
- Raum für 17 Minuten 6’23
Galerie im Taxispalais (Hg.), Innsbruck - 2010
- Atlas
Nicole Six und Paul Petritsch, Secession (Hg.), Wien
Edition: 20+2
Fotoarchiv 20.02.2010-17.10.2009
Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien
Edition: 20+2
Innere Grenze
Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien
Edition: 3+2 - 2009
- Fotoarchiv 28.09.2009-7.10.2008
Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien
Edition: 20+2 - 2008
- Fotoarchiv 05.10.2008-16.02.2007
Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien
Edition: 20+2 - 2007
- Fotoarchiv 21.01.2007-07.09.2005
Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien
Edition: 20+2 - 2005
- Fotoarchiv 16.08.2005-04.08.2004
Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien
Edition: 20+2 - 2004
- Fotoarchiv 06.06.2004-15.02.2001
Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien
Edition: 20+2
Raumbuch
Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien
Edition: 3+2
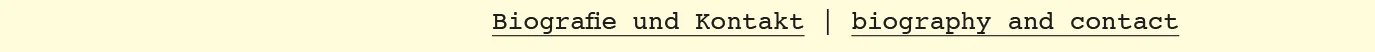
Nicole Six and Paul Petritsch have been realizing films, photographs, displays, artist books as well as site- and context-specific installations and projects in public space since 1997. They live in Vienna.
They explore the limits of our existence and our perception with expeditions into everyday life, through oceans, polar regions, concrete deserts as well as lunar landscapes. With their experimental test arrangements and interventions, they locate themselves and the viewer again and again in art spaces, architectures and landscapes.
BIOGRAPHY
Nicole Six
Born 1971 in Vöcklabruck, Austria
Academy of fine Arts Vienna, Sculpture
Paul Petritsch
Born 1968 in Friesach, Austria
University of Applied Arts Vienna, Architecture
1997 MAK Schindler Scholarship, Los Angeles
2004 International Studio & Curatorial Program / ISCP, New York
2005 Visiting Professor at Experimental Design, Kunstuniversität Linz
2006 State Fellowship for Fine Arts
2007 Kardinal König Art Award
2008 T-mobile Art Award
2008 Lectureship Modul Kunsttransfer, Institut für Kunst und Gestaltung, Vienna
2009 Austrian drawing Award
2011 - 2020 Member of the panel BIG Art – Kunst und Bau der BIG (Nicole Six)
2014 since 2014 Head of the Department Site-Specific Art, University of Applied Arts Vienna (Paul Petritsch)
2015 Member of the panel Kunsthalle Exnergasse (Paul Petritsch)
2017 Karl-Anton-Wolf-Award
2019 since 2019 board member of Camera Austria, Graz (Nicole Six)
2021 Guest professor of the Department Site-Specific Art, University of Applied Arts Vienna (Nicole Six)
2023 Lectureship at the department Kunst und Musik, Kunst und Kunsttheorie, University of Cologne (Nicole Six)
2023 Landeskulturpreis für Bildende Kunst, Upper Austria
2024 board member of Camera Austria, Graz (Nicole Six)
Landeskulturpreis für Bildende Kunst, Lower Austria
Collaboration since 1997
KONTAKT
Nicole Six and Paul Petritsch
Schottenfeldgasse 76/25
1070 Vienna/Austria
Tel. +43 1 95797 99
Fax +43 1 95797 99
Mail: office@six-petritsch.com
Nicole Six und Paul Petritsch realisieren seit 1997 gemeinsam Filme, Fotografien, Displays, Künstlerbücher sowie orts- und kontextspezifische Installationen und Projekte im öffentlichen Raum. Sie leben in Wien.
Die Grenzen unseres Daseins und unserer Wahrnehmung erforschen sie mit Expeditionen in den Alltag, durch Ozeane, Polarregionen, Betonwüsten, wie auch Mondlandschaften. Mit ihren experimentellen Versuchsanordnungen und Eingriffen verorten sie sich und die Betrachter*innen immer wieder neu in Kunsträumen, Architekturen und auch Landschaften.
BIOGRAFIE
Nicole Six
1971 geboren in Vöcklabruck, Österreich
Studium der Bildhauerei an der Akademie der bildenden Künste
Paul Petritsch
1968 geboren in Friesach, Österreich
Studium der Architektur an der Universität für Angewandte Kunst
1997 Schindlerstipendium
2004 ISCP, New York
2005 Gastprofessur am Institut für Experimentelle Gestaltung, Kunstuni Linz
2006 Staatsstipendium für bildende Kunst
2007 Kardinal König Kunstpreis
2008 T-mobile Art Award
2008 Lehrauftrag Modul Kunsttransfer, Institut für Kunst und Gestaltung, TU Wien
2009 Österreichischer Grafikwettbewerb
2011 - 2020 Jurymitglied von BIG Art – Kunst und Bau der BIG (Nicole Six)
2014 seit 2014 Leitung Abteilung für ortsbezogene Kunst, Universität für Angewandte Kunst (Paul Petritsch)
2015 Künstlerischer Beirat der Kunsthalle Exnergasse (Paul Petritsch)
2017 Karl-Anton-Wolf-Preis
2019 seit 2019 Vorstandsmitglied der Camera Austria, Graz (Nicole Six)
2021 Gastprofessorin Abteilung für ortsbezogene Kunst, Universität für Angewandte Kunst (Nicole Six)
2023 Lehrauftrag am Department Kunst und Musik, Kunst und Kunsttheorie, Universität zu Köln (Nicole Six)
2023 Landeskulturpreis für Bildende Kunst, Oberösterreich
2024 Vorstandsmitglied der Camera Austria, Graz (Nicole Six)
Landeskulturpreis für Bildende Kunst, Niederösterreich
Zusammenarbeit seit 1997
KONTAKT
Nicole Six und Paul Petritsch
Schottenfeldgasse 76/25
1070 Wien/Österreich
Tel. +43 1 95797 99
Fax +43 1 95797 99
Mail: office@six-petritsch.com
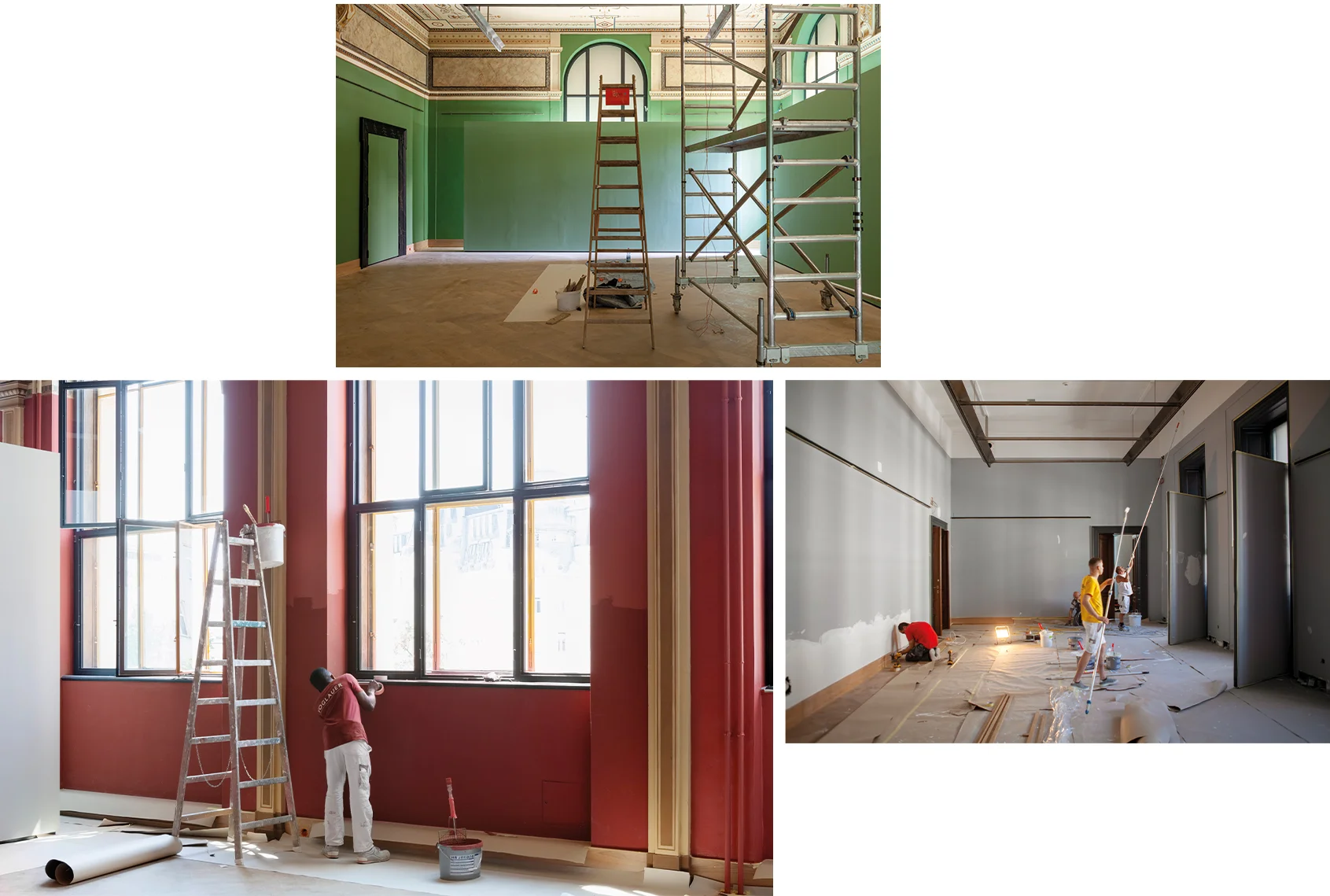
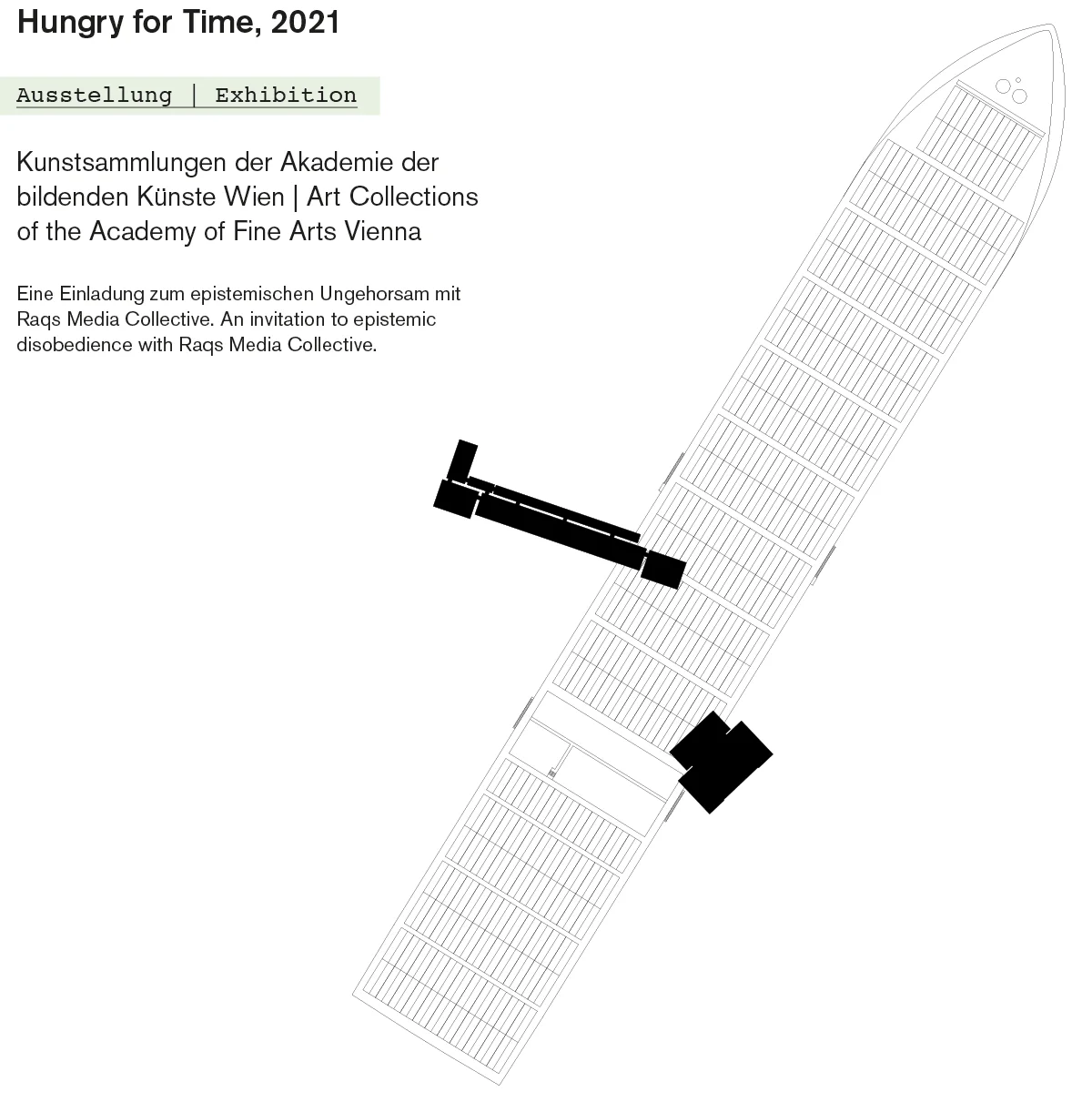
Hungry for Time. An invitation to epistemic disobedience with Raqs Media Collective, in the Art Collections of the Academy of Fine Arts Vienna
The Academy of Fine Arts Vienna has undergone a fundamental renovation and modernization and returned this summer to its historical building on Schillerplatz. For this occasion, the internationally active artist and curator trio from New Delhi, Raqs Media Collective (Jeebesh Bagchi, Monica Narula, Shuddhabrata Sengupta), was asked to survey the historical art collections—the Paintings Gallery, the Graphic Collection and the Plaster Cast Collection—from an external perspective and to mediate a thematic reorientation in dialogue with contemporary art. Hungry for Time developed through a collaboration with the Academy’s own expertise while taking the current decolonialism discourse in art and cultural studies into account, thereby opening up a new way of perceiving the art collections.
Artists in the exhibition Hungry for Time
Willem van Aelst, Nazgol Ansarinia, Joannis Avramidis, Stefano della Bella, Johann Bitterlich, Christoph Wilhelm Bock, Pieter Boel, Hieronymus Bosch, Simnikiwe Buhlungu, Domenico Campagnola, Ali Cherri, Daniel Chodowiecki, Pieter Codde, Jacques Courtois, Jean-Baptiste Decável, Discursive Justice Ensemble (Kabelo Malatsie, Michelle Wong, Lantian Xie), Nico Dockx, Albrecht Dürer, Julie Edel Hardenberg, Thomas Ender, Denise Ferreira da Silva, Jan Fyt, Bonaventura Genelli, Giovanni di Paolo di Grazia, Rajyashri Goody, Joseph Grigely, Artur Grottger, Franz Xaver Gruber, Nilbar Güreş, Johann Gottfried Haid, Abhishek Hazra, Josef Heideloff, Jan van der Heyden, Melchior d’ Hondecoeter, Jan van Huysum, Sanja Iveković, Franz Jäger d. J., Kiluanji Kia Henda, Hein Koh, Lakshmana Rao Kotturu, Pieter van Laer, Farideh Lashai, Maria Lassnig, Christine Leins, Melchior Lorch, Nicola Malinconico, Lavanya Mani, Arun Vijai Mathavan, Maria Sibylla Merian, Jan Miel, Josef Mikl, Jota Mombaça, Monogrammist A. C., Monogrammist L. F., Huma Mulji, Adriaen van Ostade, Ryan Presley, Raqs Media Collective (Jeebesh Bagchi, Monica Narula, Shuddhabrata Sengupta), Rembrandt Harmensz. van Rijn, Rachel Ruysch, Jean le Saive (Jean de Namur), Egon Schiele, Jacques van Schuppen, Ayesha Singh, Dayanita Singh, Nicole Six und Paul Petritsch, Pieter Snayers, Pieter Claesz. Soutman, Künstlerinnen-Duo SPLICE (Rohini Devasher und Pallavi Paul), Theodor Stundl, Pierre Subleyras, Fiona Tan, Pietro Tenerani, David Teniers d. J., Franz Thaler, Tizian (Tiziano Vecellio), Paul Troger, Jaret Vadera, Alice Wanke, Jan Weenix, Philips Wouwerman, Congcong Zhang sowie Abgüsse nach Michelangelo Buonarroti, Phidias, Praxiteles, Bertel Thorvaldsen u. a.
Curators: Raqs Media Collective (Jeebesh Bagchi, Monica Narula, Shuddhabrata Sengupta)
Associate Curator, Research-Coordinator: Barbara Mahlknecht
Head of the Paintings Collection: Claudia Koch
Head of the Graphic Collection: René Schober
Curator of the Plaster Cast Collection: Andrea Domanig
Exhibition Display: Nicole Six and Paul Petritsch, Mitarbeit: Lisa Prossegger und Jiri Tomicek
Hungry for Time, eine Einladung zum epistemischen Ungehorsam mit Raqs Media Collective, in den Kunstsammlungen der Akademie der bildenden Künste Wien
Die Akademie der bildenden Künste Wien ist nach umfassender Sanierung und Modernisierung im Sommer dieses Jahres in ihr historisches Gebäude am Schillerplatz zurückgekehrt. Aus diesem Anlass wurde das international tätige Künstler_innen- und Kurator_innen-Trio Raqs Media Collective (Jeebesh Bagchi, Monica Narula, Shuddhabrata Sengupta) aus Neu-Delhi eingeladen, die historischen Kunstsammlungen der Akademie – Gemäldegalerie, Kupferstichkabinett und Glyptothek – aus einer externen Perspektive zu befragen und ihre thematischen Neuausrichtungen durch den Dialog mit zeitgenössischer Kunst zu begleiten. Basierend auf der Expertise des Hauses eröffnet die Ausstellung Hungry for Time unter Einbeziehung des aktuellen Dekolonialismus-Diskurses in der Kunst und den Kulturwissenschaften die Möglichkeit der Neubetrachtung der drei Sammlungen.
Künstler_innen der Ausstellung Hungry for Time
Willem van Aelst, Nazgol Ansarinia, Joannis Avramidis, Stefano della Bella, Johann Bitterlich, Christoph Wilhelm Bock, Pieter Boel, Hieronymus Bosch, Simnikiwe Buhlungu, Domenico Campagnola, Ali Cherri, Daniel Chodowiecki, Pieter Codde, Jacques Courtois, Jean-Baptiste Decável, Discursive Justice Ensemble (Kabelo Malatsie, Michelle Wong, Lantian Xie), Nico Dockx, Albrecht Dürer, Julie Edel Hardenberg, Thomas Ender, Denise Ferreira da Silva, Jan Fyt, Bonaventura Genelli, Giovanni di Paolo di Grazia, Rajyashri Goody, Joseph Grigely, Artur Grottger, Franz Xaver Gruber, Nilbar Güreş, Johann Gottfried Haid, Abhishek Hazra, Josef Heideloff, Jan van der Heyden, Melchior d’ Hondecoeter, Jan van Huysum, Sanja Iveković, Franz Jäger d. J., Kiluanji Kia Henda, Hein Koh, Lakshmana Rao Kotturu, Pieter van Laer, Farideh Lashai, Maria Lassnig, Christine Leins, Melchior Lorch, Nicola Malinconico, Lavanya Mani, Arun Vijai Mathavan, Maria Sibylla Merian, Jan Miel, Josef Mikl, Jota Mombaça, Monogrammist A. C., Monogrammist L. F., Huma Mulji, Adriaen van Ostade, Ryan Presley, Raqs Media Collective (Jeebesh Bagchi, Monica Narula, Shuddhabrata Sengupta), Rembrandt Harmensz. van Rijn, Rachel Ruysch, Jean le Saive (Jean de Namur), Egon Schiele, Jacques van Schuppen, Ayesha Singh, Dayanita Singh, Nicole Six und Paul Petritsch, Pieter Snayers, Pieter Claesz. Soutman, Künstlerinnen-Duo SPLICE (Rohini Devasher und Pallavi Paul), Theodor Stundl, Pierre Subleyras, Fiona Tan, Pietro Tenerani, David Teniers d. J., Franz Thaler, Tizian (Tiziano Vecellio), Paul Troger, Jaret Vadera, Alice Wanke, Jan Weenix, Philips Wouwerman, Congcong Zhang sowie Abgüsse nach Michelangelo Buonarroti, Phidias, Praxiteles, Bertel Thorvaldsen u. a.
Kurator_innen: Raqs Media Collective (Jeebesh Bagchi, Monica Narula, Shuddhabrata Sengupta)
Assoziierte Kuratorin, Recherche-Koordinatorin: Barbara Mahlknecht
Sammlungsleitung Gemäldegalerie: Claudia Koch
Sammlungsleitung Kupferstichkabinett: René Schober
Kuratorin Glyptothek: Andrea Domanig
Ausstellungs-Display: Nicole Six and Paul Petritsch, Mitarbeit: Lisa Prossegger und Jiri Tomicek

presence is a space without thoughts
Die Landschaft ist unbeschrieben, hat sich scheinbar aufgelöst
– nun kann die Reise losgehen.
1
Erdkrümmung / Kartonstab in den Raum gespreizt
Bei einer Vermessung der Lage ist die Korrektur einer Höhenmessung aufgrund der Erdkrümmung schon auf kurzen Strecken unerlässlich und wächst quadratisch mit der Distanz.
2
Fell
3
Federkleid
4
Aus: Paul Auster, New York Trilogie, Hinter verschlossenen Türen, 1986
5
Abdruck (Städtische Passstücke)
Schottenfeldgasse, 2. Hof, Stiege im Hinterhofgebäude:
Rundung oberste Stufe 1. Stock
6
Sanduhr 24 Stunden
Dem Eintreffen einer Person, einer Sache, eines Ereignisses entgegensehen, wobei einem oft die Zeit besonders langsam zu vergehen scheint. Sich auf etwas wartend an einem Ort aufhalten und diesen nicht verlassen (Godot).
7
Lichteinfall

Expand the horizon through dialogue
Klagenfurt am Wörthersee is the starting point for a trip to the island of Klagenfurt in Franz-Josef-Land.
When the Tegetthoff set sail in Bremerhaven in 1872 with a crew of 24 under the command of Julius Payer and Karl Weyprecht, it was not foreseeable that her voyage would last 812 days. They will never achieve their goal of crossing the Arctic Ocean. Because they are trapped in the ice and instead explore the land that lies before them. In this way they will discover the Franz-Josef-Land, which has been called this ever since, and they will name one of the islands Klagenfurt.
The city in Austria and the barren, hard-to-reach island in the Arctic are related. The island was discovered on the Austro-Hungarian North Pole expedition and named after the Carinthian capital as thanks for Klagenfurt's support for the research trip. If you are in one of the places, it also speaks about the other. This situation - the double presence and its connections over (and despite) great distance - interests us. It is a symbol for dialogue and reorganization and serves as a model for negotiating ideas about what is our own - what is foreign, what is near - what is distant, center - edge of the world, presence - absence, everyday life - the expedition.
We determine the conditions of the trip: We try to achieve our goal in a permanent process by physically covering the route from Klagenfurt to Klagenfurt and by entering into communication and establishing an exchange at the same time - from a distance as well as on site. We enter into a dialogue with the landscape, the weather, with residents and travelers, with static and dynamic conditions. We expose visible and invisible processes, we encounter the unexpected. Some things are noticeable, others hardly. We collect, connect, document, ask questions and do calculations. Our expedition doesn't have to discover a new country; we are striving for a new measurement, a reorientation inside and outside. All of this tells this story anew, a bold undertaking, the aim of which is to dissolve boundaries and to manifest new things.
Dialogisch den Horizont expandieren
Klagenfurt am Wörthersee ist Ausgangspunkt für eine Reise zur Insel Klagenfurt im Franz-Josef-Land.
Als die Tegetthoff 1872 mit einer 24-köpfigen Mannschaft unter dem Kommando von Julius Payer und Karl Weyprecht in Bremerhaven in See stach, war nicht voraussehbar, dass ihre Reise 812 Tage lang dauern würde. Sie werden ihr Ziel, das Polarmeer zu durchqueren, nie erreichen. Denn sie werden im Eis eingeschlossen und stattdessen das Land, das vor ihnen liegt, erforschen. So werden sie das Franz-Josef-Land entdecken, das seither diesen Namen trägt, und sie werden eine der Inseln Klagenfurt nennen.
Die Stadt in Österreich und die karge, schwer erreichbare Insel in der Arktis stehen in einem Zusammenhang. Die Insel wurde auf der österreich-ungarischen Nordpol-Expedition entdeckt und zum Dank für Klagenfurts Unterstützung zur Forschungsreise nach der Kärntner Hauptstadt benannt. Befindet man sich an einem der Orte, spricht dieser auch über den anderen. Diese Situa-tion – die doppelte Präsenz und ihre Verbindungen über (und trotz) große(r) Distanz – interessiert uns. Sie ist Sinnbild für Dialog und Neuaufstellung und dient uns als Modell, Vorstellungen zu verhandeln über das Eigene – das Fremde, das Nahe – das Ferne, Zentrum – Rand der Welt, Prä-senz – Absenz, der Alltag – die Expedition.
Wir legen die Bedingungen der Reise fest: In einem dauerhaften Prozess versuchen wir unser Ziel zu erreichen, indem wir den Weg von Klagenfurt nach Klagenfurt physisch zurücklegen und indem wir parallel dazu in Kommunikation treten und einen Austausch etablieren – aus der Entfernung sowie vor Ort. Wir treten in einen Dialog mit der Landschaft, dem Wetter, mit Ansässigen und Reisenden, mit statischen und dynamischen Zuständen. Wir legen sichtbare und unsichtbare Prozesse frei, wir stoßen auf Unvorhergesehenes. Manches ist wahrnehmbar, anderes kaum. Wir sammeln, verbinden, dokumentieren, stellen Fragen und Berechnungen an. Unsere Expedition muss kein neues Land entdecken; wir streben eine Neuvermessung an, eine Neuorientierung im Inneren wie im Außen. All das erzählt diese Geschichte neu, ein kühnes Unterfangen, dessen Ziel es ist, Grenzen aufzulösen und Neues zu manifestieren.
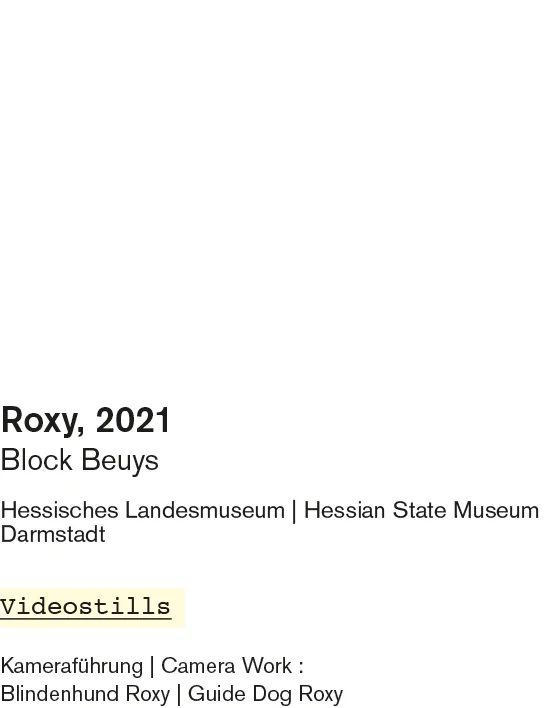

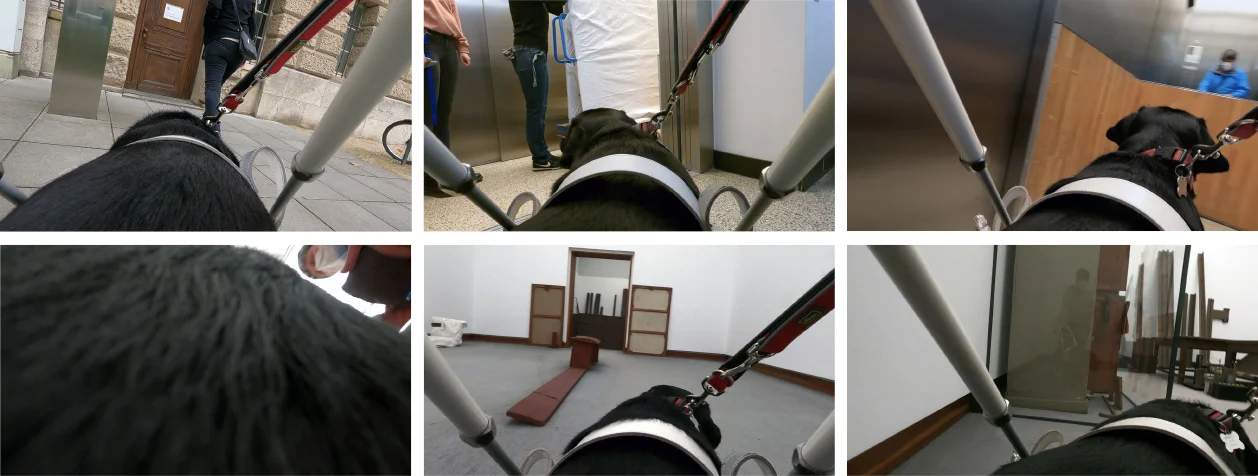
The idea of turning around the perspective in Beuys‘s dialogues with animals serves as a starting point for this work. As due to the house rules of the Hessian State Museum Darmstadt neither coyotes nor rabbits are granted access when alive, we assigned the cinematography to a guide dog. In order to support inclusion it is allowed to enter the museum. Guide dog Roxy carries the camera, enabling its owner Anna-Maria Courtpozanis to walk around the museum and experience Block Beuys. This series of images of the on-site visit now precedes the texts. It shows a route through Block Beuys and serves as introduction to the theory part. The pictures are stills from a video camera that was attached to the handle that connects the dog and a person during the tour on May 27, 2021.
Camera Technician: Jiří Tomíček
Thanks to Anna Courtpozanis and Roxy
Translation: Jeanette Pacher
Photos: Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Six und Petritsch © Block Beuys VG Bild-Kunst, Bonn 2021
Ausgangspunkt ist die Idee der Blickumkehr der Beuysschen Dialoge mit Tieren in seinen Arbeiten. Da Kojoten oder Hasen nach der Hausordnung des Hessischen Landesmuseum Darmstadt lebend der Zutritt verwehrt wird, haben wir die Kameraführung einem Blindenhund übertragen, der zur Förderung von Inklusion im Museum erlaubt ist. Die Kamera wird von dem Blindenhund Roxy geführt, der wiederum seiner Besitzerin Anna-Maria Courtpozanis ermöglicht, das Museum und Block Beuys zu begehen und zu erleben. Diese Bildstrecke der Begehung ist nun den Texten vorangestellt. Sie zeigt einen Weg durch Block Beuys und leitet die Theorie ein. Es sind Filmstills einer Videokamera, die beim Rundgang am 27. Mai 2021 am Haltegriff montiert war, der Hund und Menschen verbindet.
Kameratechnik: Jiří Tomíček
Dank an Anna Courtpozanis und Roxy
Fotos: Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Six und Petritsch © Block Beuys VG Bild-Kunst, Bonn 2021
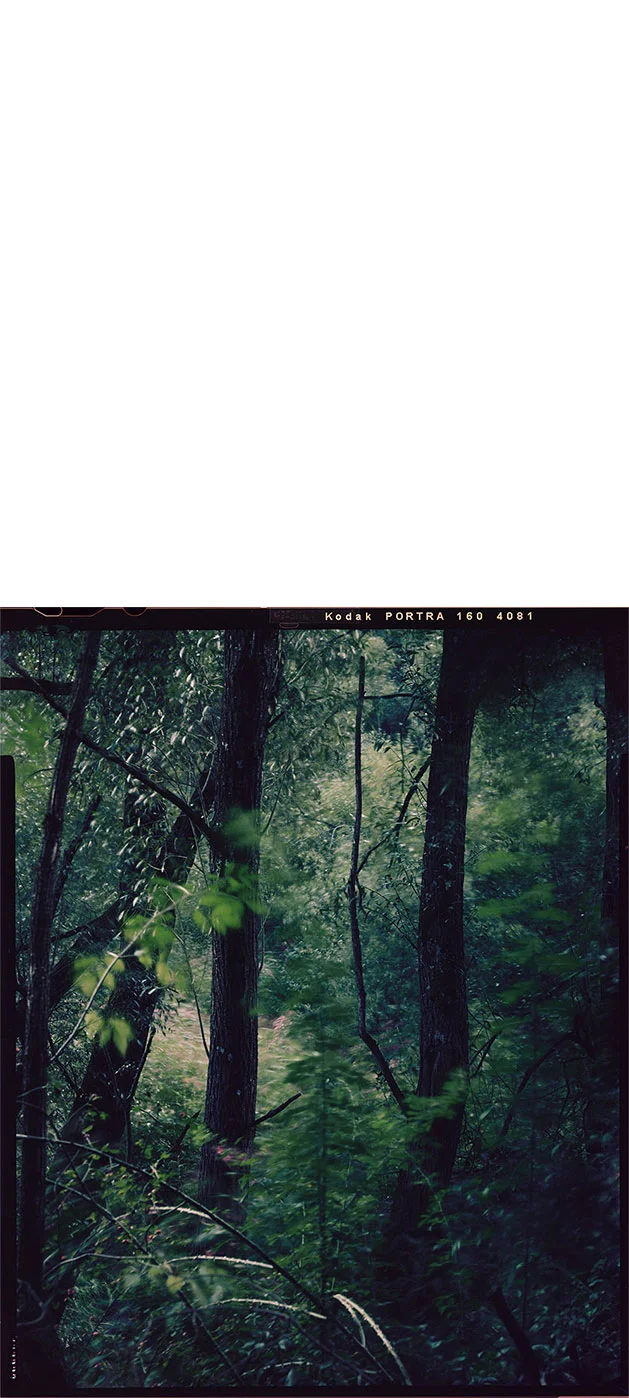


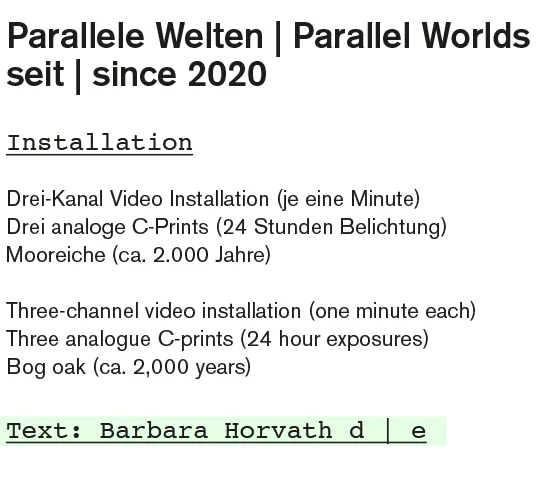
In a multilayered spatial and media installation Nicole Six and Paul Petritsch present visual recordings. Time determines the individual parts of the installation, is the essence of their development, measures change, and becomes physically perceptible.
Photographs taken with a camera obscura: Through a hole in a completely darkened box an outside scene is projected into the interior of the box and onto the side opposite the hole. In this way, over the course of 24 hours the camera captured the light of several entire days in the woods of the Waldviertel.
The video recordings shown in the installation were taken with digital cameras activated by a sensor that detects heat, light, and motion. One-minute-long film clips reveal an eerie “parallel world”: a pair of eyes flashes in the night, an animal disturbs the surface of the water, insects, particles of dust, reflections of light, and moths trigger the recordings. The camera assumes the role of a “stalker” in a wondrous and apocalyptic zone of unforeseeable events. Impassively, randomly it collects seemingly ordinary images.
The subfossilized bog oak found in a Croatian riverbed marks a point in time in the past, gives us information about geological and biological contexts, and arrives in the present as a motionless torpedo.
In einer räumlich wie medial vielschichtigen Installation zeigen Nicole Six und Paul Petritsch visuelle Aufzeichnungen. Die Zeit bestimmt die einzelnen Teile der Installation, ist die Essenz ihrer Entwicklung, misst die Veränderung und wird physisch wahrnehmbar.
Fotografien mit einer Camera Obscura: Durch die kleine Öffnung einer vollständig abgedunkelten Box wird eine äußere Szene in das Innere dieser Box projiziert, auf die der Öffnung gegenüberliegende Seite. Über einen Zeitraum von 24 Stunden wurde so in der Wildnis des Waldviertels immer wieder das Licht eines Tages eingefangen.
Die filmischen Aufnahmen der Installation wurden durch digitale Kameras aufgenommen, ausgelöst durch einen Sensor, der auf Wärme, Lichtspiegelung und Bewegung reagiert. So entstand in jeweils 1-minütigen Filmclips eine unheimliche „Parallelwelt“: ein Augenpaar blitzt auf, ein Tier bringt die Wasseroberfläche in Bewegung, Insekten, Staubpartikel, Lichtreflexionen und Nachtfalter lösen Aufnahmen aus. Die Kamera agiert gleichsam als „Stalkerin“ in einer wundersamen und zugleich apokalyptischen Zone, deren Ereignisse nicht vorhersehbar sind. Scheinbar belang- und vor allem teilnahmslos fängt sie Bilder ein.
Die in einem kroatischen Flussbett gefundene subfossile Mooreiche nimmt unsere Zeitrechnung auf, gibt Aufschlüsse über geologische und biologische Zusammenhänge, um schließlich als ein erstarrter Torpedo in der Gegenwart anzukommen.



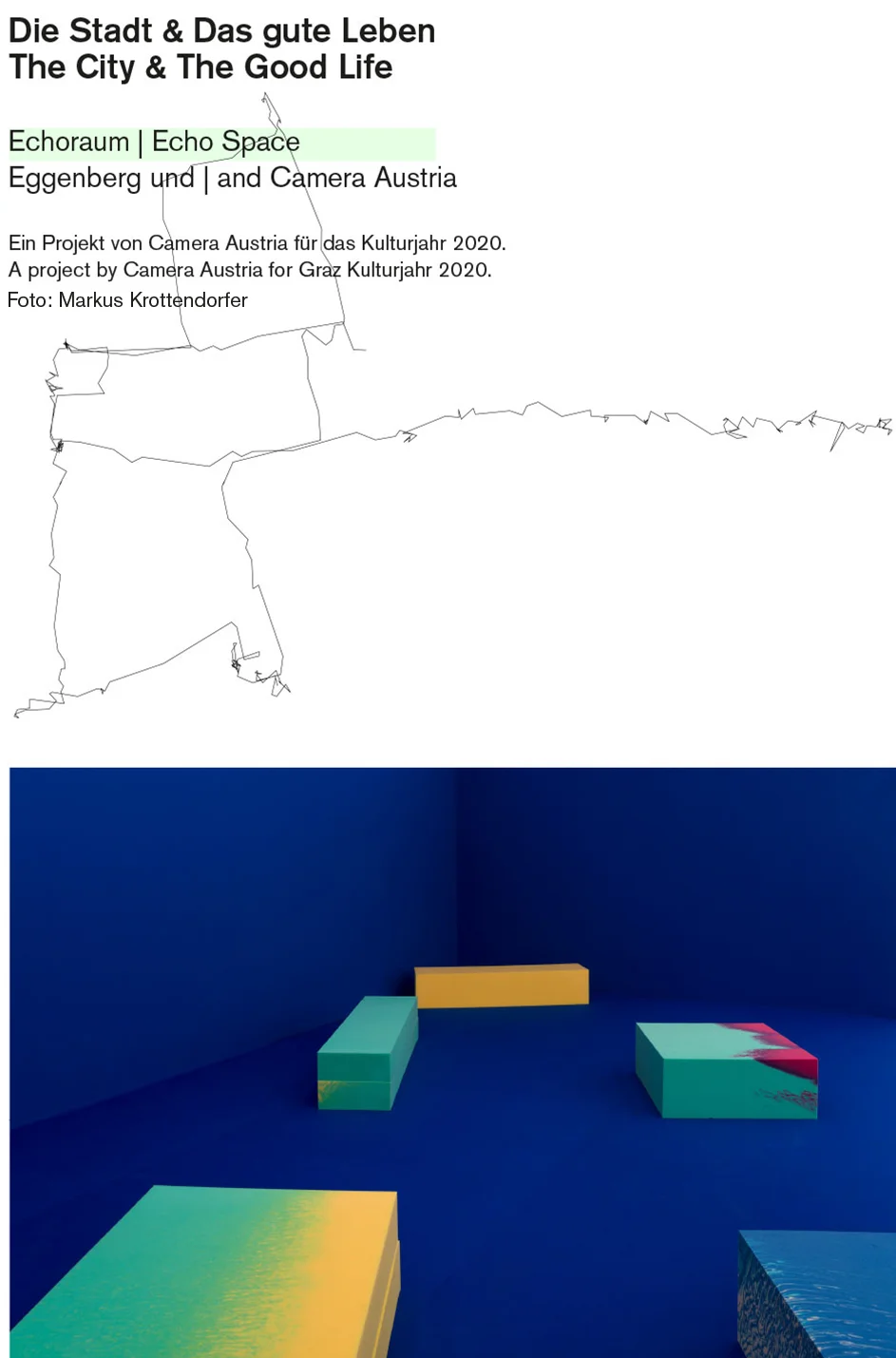

Die Stadt & Das gute Leben
In Zeiten der Krise stellen sich die gesellschaftlichen Fragen und Übereinkünfte neu. Institutionen sind gefordert ihre Stellung in der Stadt gegenüber ihrem Publikum inhaltlich zu hinterfragen und neu zu erforschen: Wer sind unsere Partner unser Gegenüber unsere Unterstützer, Wer stellt Kontent her, wer sind den eigentlich die KulturarbeiterInnen wer...
Die Camera Austria stellt sich dieser aktuellen Frage und geht in die Stadt. Sie installiert einen Echoraum, der die etablierte Institution mit jenen Initiativen verbindet und in Dialog tritt, die oft kaum sichtbar und nun besonders wichtig und zugleich gefährdet sind. Sie prägen den kulturellen Alltag und das gute Leben in der Nachbarschaft.
Intervention von Nicole Six & Paul Petritsch
Der Zugang zum Ausstellungsraum von Camera Austria ist bisher nur über den Eingang und das Foyer des Kunsthaus Graz möglich. Das Konzept der KünstlerInnen Nicole Six & Paul Petritsch sieht vor, dass eine Außentreppe von der Straße direkt in den Ausstellungsraum führt und diesen für die BesucherInnen ohne Ticket zugänglich macht: Ein für jede(n) einnehmbarer Raum der Stadt. Eine Basisausstattung bestimmt den Raum: Eine Plakatwand, Schaumstoffelemente, die sowohl Präsentationen als auch Sitzen oder Liegen während des Aufenthalts möglich machen. Bücherangebote, eine Pinnwand für Nachrichten und die Bewerbung von nichtkommerziellen Aktivitäten sowie weitere Angebote (Filme, Videos, ein Lesezirkel) sollen die Aktivitäten in diesem Raum rahmen. Eine Person ist vorgesehen, die die Nutzungen des Raumes beaufsichtigt. Eine Plakatserie begleitet eine Reihe von geführten Touren aus der Institution, aus der Innenstadt in und durch verschiedene Nachbarschaften.
Dieses Set von Eingriffen ist der Rahmen zur Entwicklung eines beweglichen, offenen Ausstellungsmodell. Camera Austria und die Stadt - exemplarisch Eggenberg - funktionieren als durchlässige Arbeits- und Archivräume, die Ausstellungen und Interventionen selbst, entstehen und manifestieren sich nun in der Stadt. Es sind nun kommunizierende Gefäse, die durch eine Vielzahl von Interventionen im Innen als auch im Außen verbunden sind.

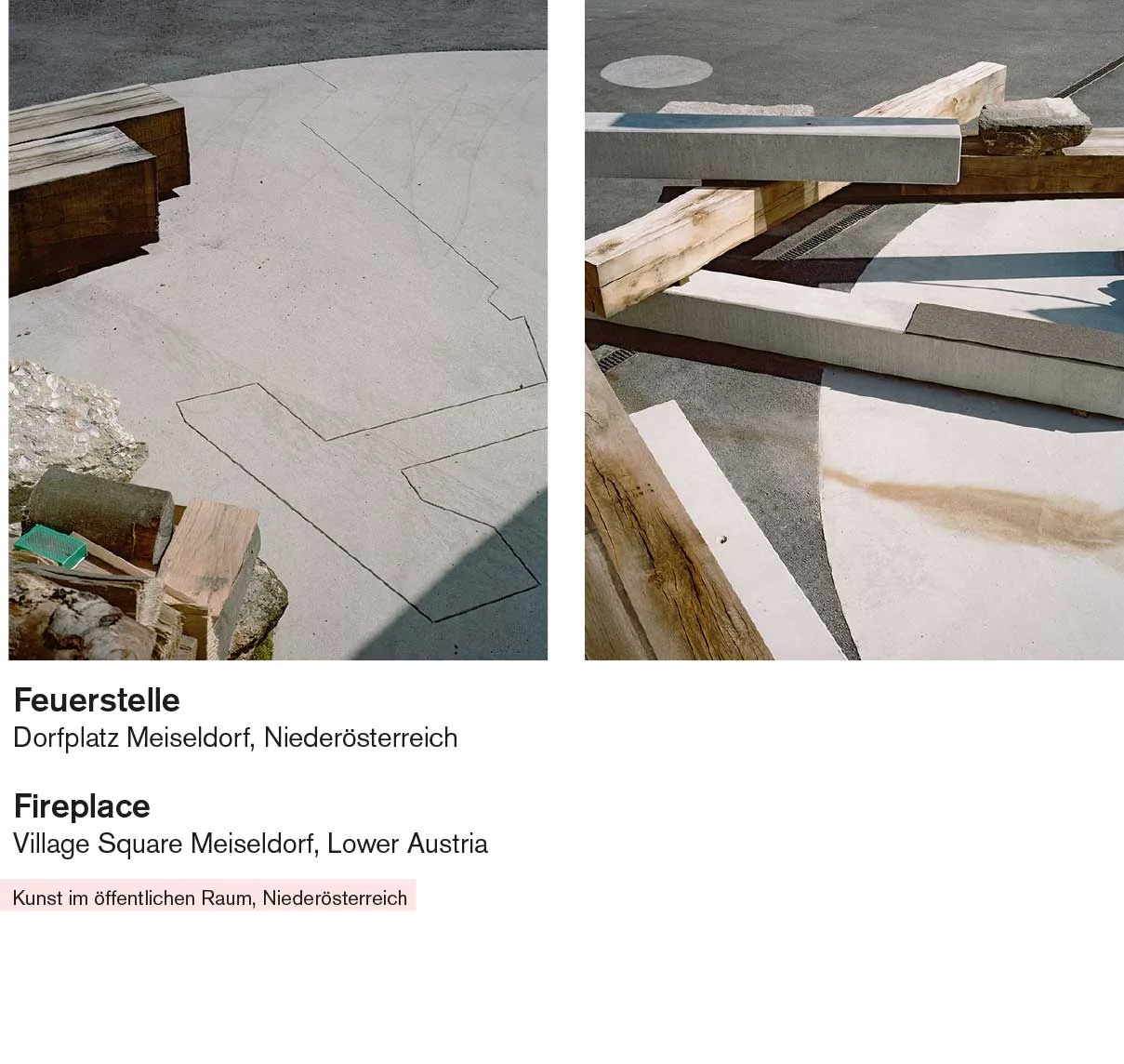


Over the past few decades, Klein-Meiseldorf, like most rural villages, has lost many of the essential elements of a small-town community: post office, its last restaurant, and a railway station. Now the local people have jointly converted a vacant building ensemble into a new community center to meet their needs and to create a space that will fulfill their desire for community. The complex was to encompass an event and exhibition space, a youth center, a grocery store, and a small café as well as a multipurpose space open to the public – a meeting place for everyone and a new identity for the entire community of Kattau, Klein-Meiseldorf, Maigen, and Stockern.
Designing of the Square
A place to get water or just to hang out / parking lot and fountain / basin for cooling drinks and feet / barbecue pit and village parties / a place for young people to gather near the youth center / for erecting the maypole together / celebrating the passing of the seasons – Easter bonfire and summer solstice festivities / for monitoring wind direction / comparing the size of the Earth and the moon, in short: The new village square in Klein-Meiseldorf – a mix of general store and multipurpose venue – is to be a place that can be used in many ways in the future and which at the same time reminds us of the history of the area.
To meet the demand of multifaceted use, which this new site is to make room for, the artist duo Nicole Six and Paul Petritsch has developed a series of versatile and contemporary solutions based on three elements: a campfire site on a circle of polished concrete, a larch-wood fountain the size of a car, and flexible seating made of various vertical and horizontal wooden beams and prefabricated concrete elements. These are interspersed with granite boulders from nearby rock quarries. In addition to these diverse objects, there is another level: Engraved in the ground are circles and lines that make reference to the Earth, the path of the sun, the date line, and other planetary systems.
Thus, inscribed in the square is a subtle intertwining of various narratives about time and the relationship of this village and its inhabitants not only to their surroundings but beyond that to the world: from primordial time, the Eggenburg Sea, and the recording of time itself, to globalization, craftsmanship, and industrial production, to solar power, water, and fire. All these components come together in a loose chain of associations that with calm ease invites visitors to ponder existential or everyday thoughts. The square welcomes locals and visitors alike to meet, rest, celebrate, and get involved – to live and experience community in all its varied forms.
Klein-Meiseldorf hat, wie die Mehrzahl der Gemeinden am Land, in den vergangenen Jahrzehnten vieles verloren, was für eine dörfliche Gemeinschaft von zentraler Bedeutung ist: die Post, das letzte Gasthaus und eine Haltestelle an der Franz-Josefs Bahn. Nun haben sich die BewohnerInnen zusammengetan und entsprechend ihrer Bedürfnisse an der Stelle eines leerstehenden Gebäudeensembles ein neues Dorfzentrum geschaffen, um ihren Wunsch nach Gemeinschaft wieder Raum zu geben. Dieser Ort sollte einen Veranstaltungs- und Ausstellungsraum, ein Jugendzentrum, einen Nahversorger und ein kleines Café sowie ein öffentlichen Raum für vielfältige Nutzungsmöglichkeiten beinhalten – einen Treffpunkt für alle und eine neue Identität für die gesamte Gemeinde, bestehend aus Kattau, Klein-Meiseldorf, Maigen und Stockern, bilden.
Die Platzgestaltung
Wasserholen oder einfach Herumsitzen / Parkplatz und Wasserbecken / Getränke und Füße kühlen / Grillplatz und Dorffest / Treffpunkt für Jugendliche neben dem Jugendzentrum / gemeinsames Maibaumaufstellen / den Jahresablauf zelebrieren – Osterfeuer und Sonnwendfeier / die Windrichtung im Blick haben / das Größenverhältnis von Erde und Mond zeigen, kurz: der neue Dorfplatz in Klein-Meiseldorf, zwischen Einkaufsmöglichkeit und Veranstaltungssaal, soll zukünftig vielfältig nutzbar sein und gleichzeitig an die Geschichte der Gegend erinnern.
Das KünstlerInnen-Duo Nicole Six und Paul Petritsch hat für diese facettenreichen Verwendungsmöglichkeiten, die dieser neue Ort Raum bieten sollte, vielschichtige und zeitgemäße Lösungen entwickelt, die auf drei Elementen basieren: einer Feuerstelle auf einer geschliffenen Betonfläche, einem Brunnen aus Lärchenholz in der Dimension eines parkenden Autos und einem flexiblen „Sitzmobiliar“ aus stehenden und liegenden Holzbalken und Betonfertigteilen.
Dazwischen verteilen sich Gesteinsbrocken aus den umliegenden Steinbrüchen. Neben den Objekten gibt es eine weitere Ebene: in den Boden gezeichnete Kreise und Linien verweisen auf die Erde, den Sonnenverlauf, die Datumsgrenze und andere Planetensysteme.
Dem Platz ist so ein subtiles Geflecht von verschiedenen Erzählungen über die Zeit und das Verhältnis dieses Ortes und seiner BewohnerInnen zur Umgebung und weiter zur Welt eingeschrieben: von der Urzeit, das Eggenburger Meer, die Zeitrechnung an sich, über die Globalisierung, das Handwerk, die industrielle Fertigung bis hin zu Solarstrom, Wasser und Feuer. All diese Komponenten verbinden sich zu einer losen Assoziationskette, die die BesucherInnen mit unaufgeregter Leichtigkeit einlädt gedanklich vom Existentiellem zum Alltäglichen zu schweifen. Der Platz heißt BewohnerInnen und Gäste willkommen und lädt ein, sich hier zu treffen, sich auszuruhen, zu feiern und aktiv zu werden - Gemeinschaft in seinen unterschiedlichen Formen zu leben.
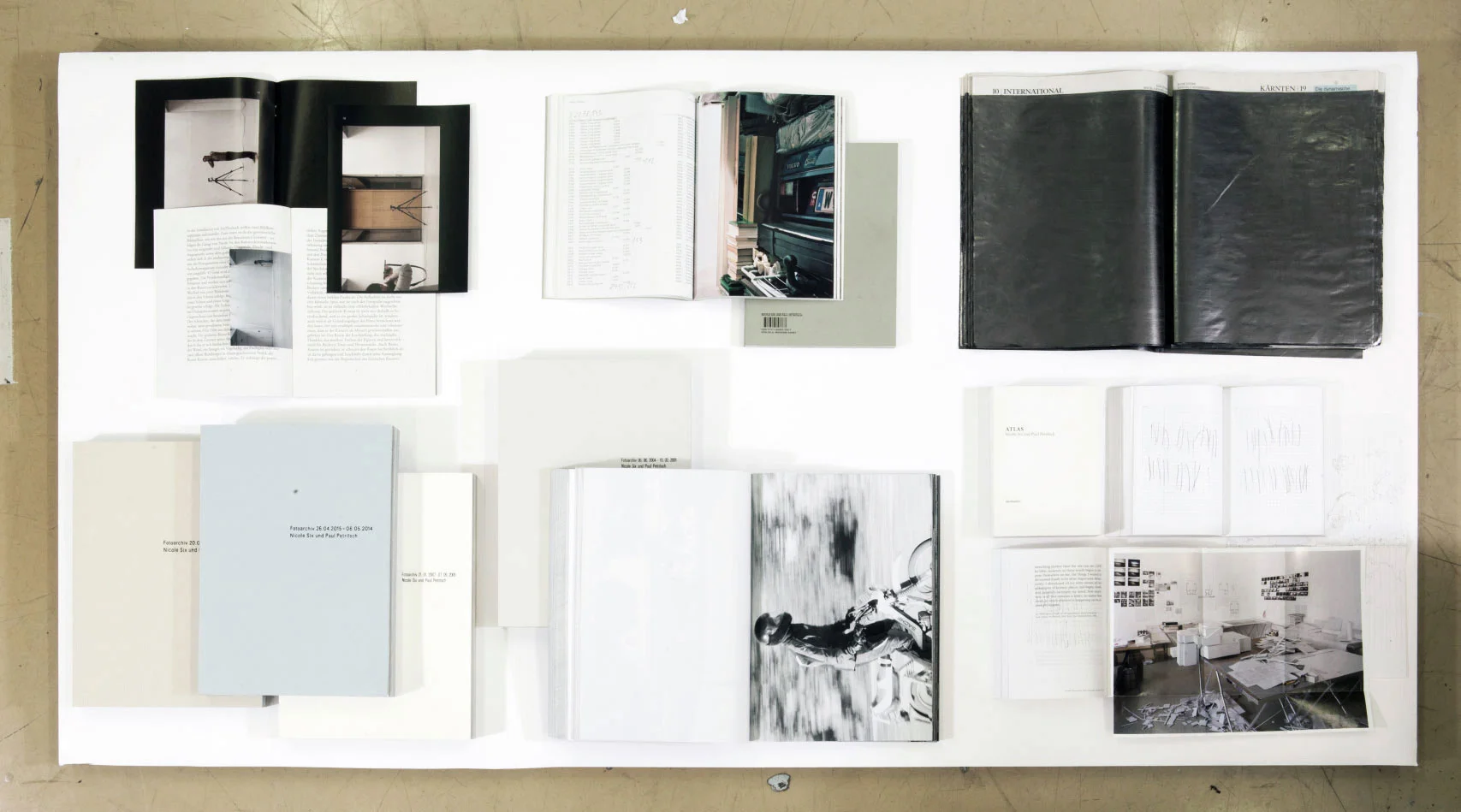
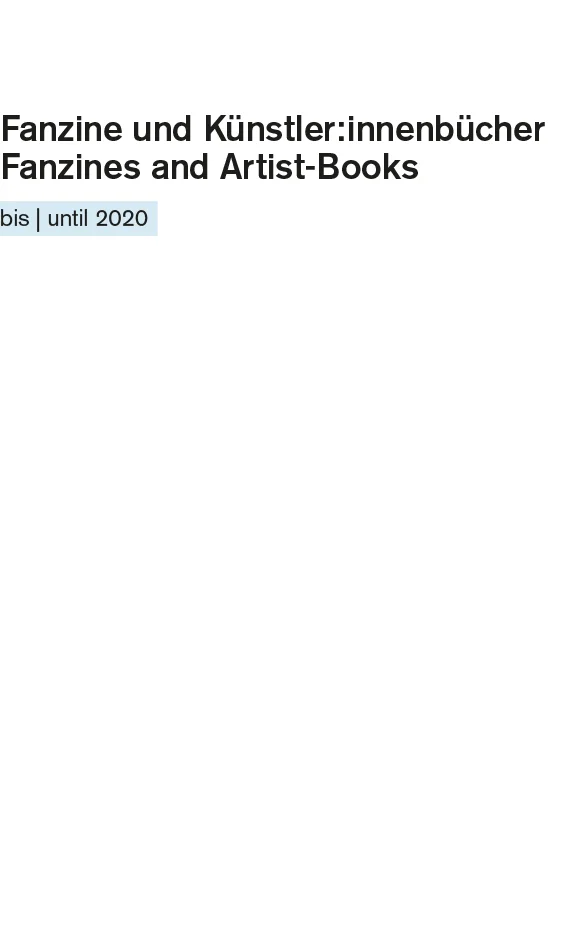
Fanzines and Artist-Books
2020, Unplugged, David Korecky, Galerie Rudolfinum (eds.), Prag, Edition: 99 / 2018, Lost and Found, Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Wien, Edition: 8+2 / 2016, Fotoarchiv 30.06.2016-26.04.2015, Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Wien, Edition: 20+2 / 2015, Fotoarchiv 26.04.2015-06.05.2014, Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Wien, Edition: 20+2 / 2014, Das Meer der Stille, Landesgalerie Linz / Barbara Schröder (eds.), Linz; Fotoarchiv 14.04.2014-10.07.2012, Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Wien, Edition: 20+2 / 2012, Aussicht kann durch Ladung verstellt sein, Kunstverein Medienturm (eds.), Graz, Edition: 20+2; Fotoarchiv 20.04.2012-09.03.2010, Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Wien, Edition: 20+2 / 2011, Raum für 17 Minuten 6’23’’, Galerie im Taxispalais (eds.), Innsbruck / 2010, Atlas, Nicole Six und Paul Petritsch, Secession (eds.), Wien, Edition: 20+2; Fotoarchiv 20.02.2010-17.10.2009, Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Wien, Edition: 20+2; Innere Grenze, Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Wien, Edition: 3+2 / 2009, Fotoarchiv 28.09.2009-7.10.2008, Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Wien, Edition: 20+2 / 2008, Fotoarchiv 05.10.2008-16.02.2007, Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Wien, Edition: 20+2 / 2007, Fotoarchiv 21.01.2007-07.09.2005, Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Wien, Edition: 20+2 / 2005, Fotoarchiv 16.08.2005-04.08.2004, Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Wien, Edition: 20+2 / 2004, Fotoarchiv 06.06.2004-15.02.2001, Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Wien, Edition: 20+2; Raumbuch, Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Wien, Edition: 3+2
Fanzine und Künstler:innenbücher
2020, Unplugged, David Korecky, Galerie Rudolfinum (Hg.), Prag, Edition: 99 / 2018, Lost and Found, Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien, Edition: 8+2 / 2016, Fotoarchiv 30.06.2016-26.04.2015, Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien, Edition: 20+2 / 2015, Fotoarchiv 26.04.2015-06.05.2014, Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien, Edition: 20+2 / 2014, Das Meer der Stille, Landesgalerie Linz / Barbara Schröder (Hg.), Linz; Fotoarchiv 14.04.2014-10.07.2012, Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien, Edition: 20+2 / 2012, Aussicht kann durch Ladung verstellt sein, Kunstverein Medienturm (Hg.), Graz, Edition: 20+2; Fotoarchiv 20.04.2012-09.03.2010, Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien, Edition: 20+2 / 2011, Raum für 17 Minuten 6’23’’, Galerie im Taxispalais (Hg.), Innsbruck / 2010, Atlas, Nicole Six und Paul Petritsch, Secession (Hg.), Wien, Edition: 20+2; Fotoarchiv 20.02.2010-17.10.2009, Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien, Edition: 20+2; Innere Grenze, Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien, Edition: 3+2 / 2009, Fotoarchiv 28.09.2009-7.10.2008, Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien, Edition: 20+2 / 2008, Fotoarchiv 05.10.2008-16.02.2007, Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien, Edition: 20+2 / 2007, Fotoarchiv 21.01.2007-07.09.2005, Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien, Edition: 20+2 / 2005, Fotoarchiv 16.08.2005-04.08.2004, Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien, Edition: 20+2 / 2004, Fotoarchiv 06.06.2004-15.02.2001, Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien, Edition: 20+2; Raumbuch, Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien, Edition: 3+2




UNPLUGGED
13 August – 29 November 2020
Unplugged is an international group exhibition whose title is taken from a musical term denoting a performance played on acoustic instruments. We have invited artists to prepare a project on the theme “environmental thinking”.
As an institution, we are interested in the possibilities of leaving our comfort zone and reducing the financial resources expended on the production of artificial materials and their transport, while maintaining the professionalism of institutional representation throughout. We wish to point to qualities that we tend to overlook because of the ready availability of machine and automated production. The show’s key elements include an emphasis on daylight and the physical experience of encountering art.
John Cage. Habima Fuchs, Rinus van de Velde, unconductive trash, Tomáš Džadoň, Patricie Fexová, Tomáš Moravec, Lenka Vítková, Nicole Six & Paul Petritsch
UNPLUGGED
13 August – 29 November 2020
Unplugged is an international group exhibition whose title is taken from a musical term denoting a performance played on acoustic instruments. We have invited artists to prepare a project on the theme “environmental thinking”.
As an institution, we are interested in the possibilities of leaving our comfort zone and reducing the financial resources expended on the production of artificial materials and their transport, while maintaining the professionalism of institutional representation throughout. We wish to point to qualities that we tend to overlook because of the ready availability of machine and automated production. The show’s key elements include an emphasis on daylight and the physical experience of encountering art.
John Cage. Habima Fuchs, Rinus van de Velde, unconductive trash, Tomáš Džadoň, Patricie Fexová, Tomáš Moravec, Lenka Vítková, Nicole Six & Paul Petritsch
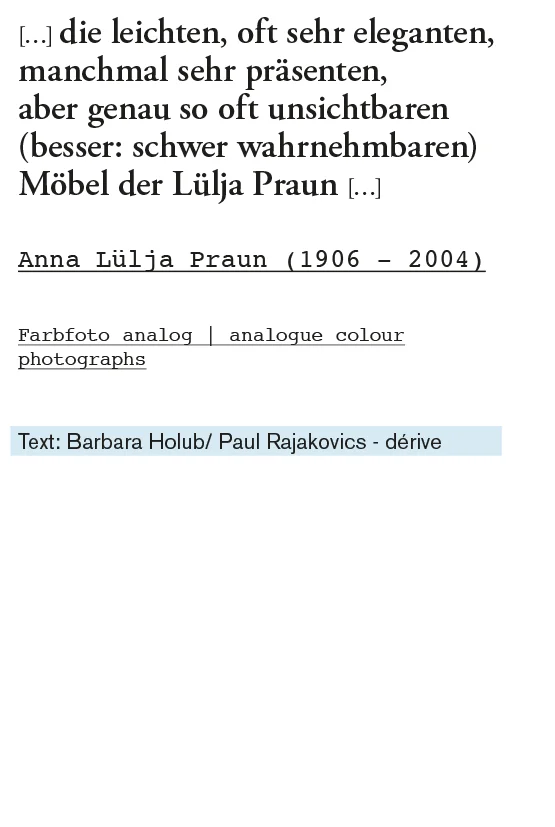


In ihrem dérive-Insert zeigen die beiden KünsterInnen ein neues noch offenes Projekt über die österreichische Architektin und Designerin Anna Lülja Praun.
Die Arbeiten von Anna Lülja Praun (1906 - 2004) haben erst spät in ihrem langen Leben Anerkennung gefunden, teils weil sie „nur“ als Mitarbeit bei Herbert Eichholzer und Clemens Holzmeister aufscheint und der Großteil ihrer eigenen Möbel und Objekte erst ab 1952 nach der Trennung von Richard Praun entstanden ist, teils weil ihre Arbeiten kaum als Massenprodukte konzipiert waren (abgesehen von einem Sessel, der von Wiesner Hager produziert wurde). Manchmal ist bei ihren Arbeiten durch ihre unterschiedlichen Kooperationen nicht immer sofort eine klar erkennbare Autorenschaft erkennbar. Man könnte sogar sagen, daß Anna Lülja Praun eine gewisse Vorreiterrolle partizipativer Arbeitsweisen einnimmt, was aber keineswegs die Qualität der Arbeiten selbst schmälert. Vielmehr bleiben dadurch manche ihrer Möbel, die oft auch Unikate geblieben sind, immer noch unentdeckt in privaten Räumen oder tauchen recht unprätentiös auf digitalen Verkaufsplattformen auf.
Six/Petritsch setzen genau hier an. In den Fotoarbeiten von Six/Petritsch bleiben die Designobjekte in ihrem gewohnten Ambiente und unter Einbindung alltäglicher Benutzung jenseits von Inszenierung. Die analoge Mittelformatkamera geht unter Anleitung des Künstlerduos quasi auf Spurensuche nach Objekten und Möbeln von Anna Lülja Praun und deren Benutzung. Dabei entstehen eigene Erzählstränge in der Abwesenheit der eigentlichen BenutzerInnen, deren Identität nur erahnt werden kann. Ebenso findet die Kamera in der Ambivalenz der Standpunkte es offen, wo nun eine echte „Anna Lülja Praun“, bzw. wo sich ein anderer Alltagsgegenstand befindet.
Die beiden für das Insert verwendeten Photographien sind im Vorraum einer Wohnung (Garderobe) und in einem Atelier (Tischlampe) in Wien aufgenommen worden.
Text: Barbara Holub/ Paul Rajakovics



The Ties Loosen
Nothing less than the space revolution, the overcoming of gravity, was what artists like Friedrich Kiesler, Theo van Doesburg, or El Lissitzky had on their minds when they gave form to their lofty plans in the 1920s. Aviation, photography, and steel structures inspired the development of new forms that were no longer bound to the Earth.
Curated by Susanne Neuburger, Reading Time in Space is the fitting title of an exhibition about transformations of spatial perception, which brings together artwork from 1910 to 1955 culled from mumok’s collection. Nicole Six and Paul Petritsch are commissioned to design the display – more accurately meta display – for the show. The centerpiece of the exhibition is the L+T System that Friedrich Kiesler developed in 1924 for the International Exhibition of New Theater Techniques. The idea was simple and at the same time groundbreaking. Kiesler designed a cluster of horizontal and vertical presentation surfaces, grouping them into modules and arranging them in a three-dimensional system. The decisive aspect was how he used sculptural means to modulate spatial experience and perception and direct and control gazes. And with the L+T System he formulates an idea that he will implement a year later in 1925 with his City in Space, which is again a display system, this time for the presentation of models by Austrian stage designers at the International Exposition of Decorative Arts in Paris. Kiesler detached the installation from the floor by suspending a construction made of wooden beams and panels in a darkened room, as if to overcome space, or even conquer outer space. With their meta structure, Nicole Six and Paul Petritsch pick up Kiesler’s ideas and develop them further. The most striking element employed by Six/Petritsch is a system of vertical, metal, ceiling-to-floor supports painted red. Into these, the wall elements are inserted in a spatial grid. Various wall modules are used for this purpose including white and black louvers as well as mirrored and opaque white panels. A further important formal element is the horizontal surface, which can be seen as a platform, stand, step, table, or floor. For these surfaces Six/Petritsch turned to industrial floor elements used in office construction. Covered with carpets from trade fairs or coated with aluminum film, the modules bear information and exhibition labels as well as several works themselves. Along with the development of aviation came the transformation of spatial perception based on the simple fact that all sides of a cube have the same value – that one has to look at the bottom and top as well as the front and back. This had an enormous impact on the development of architecture but also on our imagination and notions for trying to overcome gravity. It is no coincidence that Theo van Doesburg’s counter compositions in which the roof and wall planes oscillate in a perpetual interaction between vertical and horizontal orientation appear to anticipate digital tools for the representation of three-dimensionality because our consciousness of new technological developments is tied to our visual imagination. This makes the diverse aesthetic strategies that deal with the expansion of space – as can be found in the artwork of the exhibition – seem all the more insightful. Six/Petritsch pick up these various artistic forms of expression as impulses and use their display to intensify them. This is especially obvious in Kiesler’s L+T System, which is integrated in the exhibition as a reconstruction, but also in the architecture and theater models by Adolf Loos, Gerrit Rietfeld, and Walter Gropius, who examined the interplay of surfaces in connection with movement in space.
The various surfaces of the walls and platforms allow Six/Petritsch to accentuate certain aspects of temporality in the image itself. The metal louvers, which remind us among other things in particular of El Lissitzky’s demonstration space, add rhythm to the movement in the room, or René Magritte’s 1959 painting “La Voix du sang” hangs on a mirrored wall, producing multiple refractions not only of the reflections of the room but of the viewer him- or herself. With this disarray, Six/Petritsch create a surreal moment that propagates itself in the glittering surfaces of the horizontal panels and in doing so almost seems to blur the exhibition space and its expansive tendencies. In this setting, sculptures and three-dimensional representations like Giacometti’s “Buste de Diego” (1955) are left to their own devices, they are alone with themselves and lay claim to a universal space. The technoid character of the platforms with their various surface coverings, the metal frames with their visible screws, and the red supports all speak the same language of industry and mass production and underscore in this way the machine character of the form, which at least at the beginning of the twentieth century was perceived as Modernism’s promise to conquer (outer) space. A hundred years later, industrial materials and prefabrication stand for rationalization, economization, but also democratization.
On the existing walls of the exhibition space Six/Petritsch have mounted monochrome panels. In addition to a sharp blue, which can be interpreted as the color space of a blue box, there is the absorbing color black, symbolic of film and photography. Since blue does not occur in the human body, it is suitable for the technique used to combine real images with virtual ones. The reference to blue-screen technology, which is mainly employed in film and television, serves in Six/Petritsch’s display as a reference to the new virtual image technologies, which represent yet another expansion of space, this time not to outer space but into the World Wide Web.
Thus, Six/Petritsch’s meta display loosens the ties of Modernism so that it can be read in the space of the present.
Die Fesseln lösen sich
Nichts Geringeres als die Raumrevolution, die Überwindung der Schwerkraft hatten Künstler wie Friedrich Kiesler, Theo van Doesburg oder El Lissitzky im Sinn, als sie ihre hochfliegenden Pläne in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts Form werden ließen. Luftfahrt, Fotografie und Stahlkonstruktionen befeuerten die neuen Formentwicklungen rund um die Loslösung von der Erde.
Im Raum die Zeit lesen’ lautet folgerichtig der Titel der von Susanne Neuburger kuratierten Ausstellung, die Kunstwerke der Sammlung des mumok aus dem Jahren 1910-1955 zusammenführt, die sich mit den Transformationen der Raumwahrnehmung befassen. Nicole Six und Paul Petritsch wurden mit der Aufgabe betraut, das Display, besser ein Meta-Display, für die Sammlungsschau zu entwerfen. Denn im Zentrum der Ausstellung steht das Leger und -Trägersystem von Friedrich Kiesler, das dieser im Jahr 1924 für die ‚Internationale Ausstellung neuer Theatertechnik’ entwickelt hatte. Der Gedanke war simpel und doch bahnbrechend. Horizontale und vertikale Präsentationsflächen organisierte Kiesler im Verbund und gruppierte sie zu raumgreifenden Modulen. Entscheiden dabei war, mit skulpturalen Mitteln die Raumerfahrung und Wahrnehmung zu modulieren, Blicke zu führen und zu lenken. Und mit dem Leger und -Trägersystem wurde bereits eine Idee vorformuliert, die Kiesler ein Jahr später, nämlich 1925 mit der ‚Raumstadt’ umsetzen sollte. Bei der ‚Raumstadt’ handelte es sich abermals um ein Display für die Präsentation von Modellen österreichischer Bühnenbildner auf der ‚Exposition des Arts Decoratifs’ in Paris. Kiesler löste die Installation vom Boden, indem er eine Konstruktion aus Holzbalken und Platten in einen verdunkelten Raum hängen ließ und damit den Raum, mehr noch den Weltraum zu erobern schien.
Nicole Six und Paul Petritsch zitieren mit ihrer Meta-Struktur Kieslers Ideen, greifen sie auf und entwickeln sie weiter. Das prägendste Element das Six/Petritsch einsetzen ist ein Stützsystem aus vertikalen rot lackierten Metallstreben, die die gesamte Raumhöhe des mumok durchmessen. In einem Raumraster sind Wandelemente eingelassen. Als Wandmodule kommen weiß und schwarz lackierte Lamellen, verspiegelte, sowie deckend weiß gestrichene Wände zu Einsatz. Ein weiteres zentrales Formelement bilden horizontale Flächen, die als Plattform, Podest, Stufe, Tisch oder Boden gesehen werden können. Bei diesen Flächen griffen Six/Petritsch auf industriell gefertigte Bodenelemente zurück, die im Bürobau zum Einsatz kommen. Die mit einer Aluminiumfolie beschichteten und mit Messe-Teppichen belegten Module dienen als Informations und zugleich als -Präsentationsfläche. Die mit der Entwicklung der Luftfahrt einhergehende Transformation der räumlichen Wahrnehmung, die auf der einfachen Tatsache beruht, dass alle Seiten eines Kubus den gleichen Stellenwert haben, dass also Boden und Decke genauso wie Vorder und -Rückwand zu betrachten sind, hatte enorme Auswirkungen auf die Entwicklung der Architektur, aber auch auf die Imagination und Vorstellungskraft, mit der man die Schwerkraft zu überwinden suchte. Es ist kein Zufall, dass Theo van Doesburgs Kontrakonstruktionen bei denen Dach und Wandpaneele in einem fortwährenden Spiel zwischen vertikaler und horizontaler Ausrichtung oszillieren, digitale Werkzeuge für die Darstellung von Dreidimensionalität vorwegzunehmen scheinen. Denn das Bewusstsein für neue technologische Entwicklungen ist an die optische Vorstellungskraft gebunden. Umso aufschlussreicher erscheinen die vielfältigen ästhetischen Strategien, die sich mit der Expansion des Raumes beschäftigen, wie es in den künstlerischen Arbeiten der Ausstellung zum Ausdruck kommt. Six/Petritsch nehmen diese unterschiedlichen künstlerischen Ausdrucksformen als Impulse auf, um sie vice versa durch das Display zu verstärken. Besonders augenscheinlich wird dies an Kieslers Leger und -Trägersystem, dessen Rekonstruktion als Ausstellungsstück integriert ist, aber auch an den Architektur- und Theatermodellen von Adolf Loos, Gerrit Rietfeld und Walter Gropius, die das Spiel der Flächen in Bezug auf die Bewegung im Raum in den Blick nahmen.
Die unterschiedlichen Oberflächen der Wände und Podeste wiederum ermöglichen Akzentuierungen hinsichtlich der Zeitlichkeit im Bild selbst. Die metallenen Lamellen, die nicht zuletzt an El Lissitzkys Demonstrationsraum denken lassen, rhythmisieren die Bewegung im Raum oder René Magrittes Bild ‚La Voix du sang’ aus dem Jahr 1959 hängt auf einer verspiegelten Wand wodurch nicht nur der Raum, sondern auch der oder die Betrachter*in selbst an den Spiegelungen vielfach gebrochen wird. Mit dieser Verunklärung schaffen Six/Petritsch ein surreales Moment, das sich in der glitzernden Oberfläche des horizontalen Paneele fortsetzt und dabei den Raum mit seinem expansiven Anspruch beinahe aufzulösen scheint. In diesem Setting werden Skulpturen und Plastiken wie Giacomettis ‚Buste de Diego’ (1955) auf sich selbst zurückgeworfen, sie sind bei sich und erheben dabei Anspruch auf einen universalen Raum. Der technoide Charakter der beschichteten Podeste, die sichtbare verschraubten Metallrahmen, sowie die roten Streben sprechen allesamt die Sprache der Industrie, der Massenfertigung und betonen damit den Maschinencharakter der Form, die zumindest am Beginn der 20. Jahrhunderts als Versprechen der Moderne auf die Eroberung des (Welt)raumes empfunden wurde. Hundert Jahre später stehen industrielle Materialien und Fertigungen für Rationalisierung, Ökonomisierung aber auch Demokratisierung.
Auf den bestehenden Wänden des Ausstellungsraumes von Six/Petritsch wurden monochrome Farbfelder angebracht. Neben einem scharfen Blau, das als Farbraum einer Blue Box gelesen werden kann, ist es die absorbierende Farbe Schwarz, -Symbolfarbe für Film und Fotografie. Da Blau im menschlichen Körper nicht vorkommt, ist sie für jene Technik geeignet, mit der reale Bilder mit virtuellen Bildern kombiniert werden können. Der Verweis auf die Bluescreen-Technik, die in erster Linie für Film und Fernsehen eingesetzt wird, fungiert im Display von Six/Petritsch als Hinweis auf die neuen virtuellen Bildtechnologien, die einmal mehr eine Expansion des Raumes darstellen, diesmal nicht in den Weltraum sondern in das World Wide Web.
Six/Petritsch’s Meta-Struktur löst damit die Fesseln der Moderne und macht diese im Raum der Gegenwart lesbar.

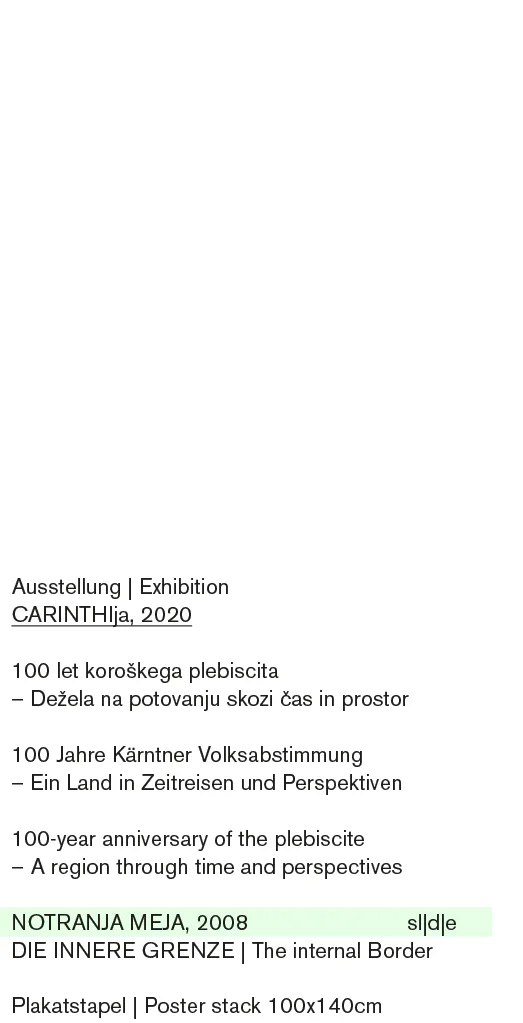
Die Innere Grenze/ Notranja meja
After World War One an area in Carinthia’s south east, where the majority of the population spoke Slovene, was claimed by the SHS state (the “Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes”). On October 10, 1920 a plebi- scite decided upon the national future of these parts: just under 60 % of the population living there voted against secession and for union with Austria.
On the occasion of the K08 exhibition we the course of the border as it was then planned examine on the basis of the map of the plebiscite. Visiting and walking the length of that frontier line is being documented photographically. By analogy to cartographic methods we put a certain screen across the map, thus defining place, viewpoint and line of sight of the photos.
Die Innere Grenze/ Notranja meja
Po prvi svetovni vojni je novonastala država SHS (Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev) zase zahtevala jugovzhodne dele Koroške, kjer je bilo večinsko prebivalstvo slovensko. 10. oktobra 1920 so tamkajšnji prebivalci na koroškem plebiscitu odločali o državni pripadnosti na teh območjih. Nekaj manj kot 60% prebivalcev je glasovalo za pripadnost Avstriji.
V okviru razstave K08 raziskujemo na podlagi takratnih plebiscitnih glasovnic predviden potek meje. Obisk in obhod meje smo fotografsko doku- mentirali. Lokacijo in smer pogleda posameznih fotografij smo določili s pomočjo kartografskih metod tako, da smo čez geografsko karto poveznili raster plebiscitnih glasovnic.
Die Innere Grenze/ Notranja meja
Nach dem Ersten Weltkrieg waren die mehrheitlich von Slowenen bewohnten Gebiete im Südosten Kärn- tens durch den SHS-Staat (Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen) beansprucht worden. Am 10. Oktober 1920 wurde per Volksabstimmung über die staatliche Zugehörigkeit dieser Gebiete entschieden: Knapp 60% der dort lebenden Bevölkerung stimmte für einen Verbleib bei Österreich.
Anlässlich der Ausstellung K08 untersuchen wir an- hand der Abstimmungskarte den damals erwogenen Grenzverlauf. Das Aufsuchen und Begehen der Grenze wird von uns fotografisch dokumentiert. Ort und Blickrichtung der jeweiligen Fotoaufnahmen wurden – in Anlehnung an kartografische Methoden – allein durch ein bestimmtes Raster, das wir über die Karte legten, definiert.

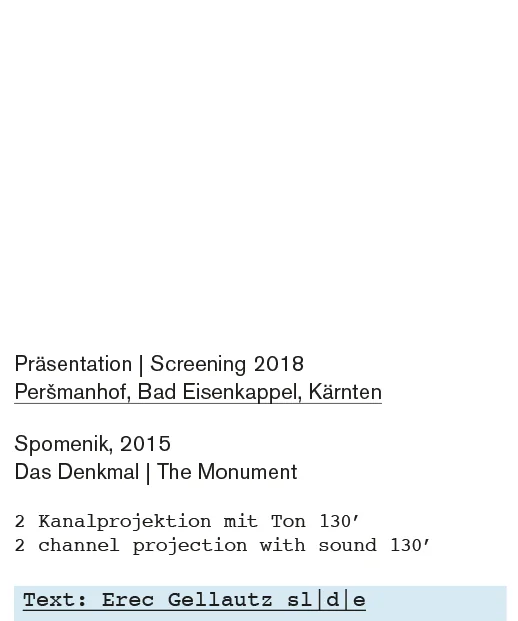


Reordering Space. Esthetic and Political Dimensions of Nicole Six and Paul Petritsch’s Carinthian Works
Political activity is that which shifts a body from the place it was assigned to or changes the purpose of a place; it lets us see what was not intended to be seen.
Jacques Rancière, Das Unvernehmen. Politik und Philosophie, Frankfurt am Main 2002, p. 41.
Following the basic tenor of this book, this essay shall examine the concept “movement” in its characteristic ambiguity. Its range of meanings brings together esthetic, political, and spatial dimensions. One may even go so far as to attribute an epistemic potential to movement phenomena: It is no coincidence that the concept “discourse” (Fr. discours) derives from the Latin word discurrere, which means to run about. It refers to the running about of an oration or the process of “thinking as the movement of thoughts, as a running about of the mind”.[1] Inspired by this spectrum of meanings, the projects realized in Carinthia by the Austrian artist duo Nicole Six and Paul Petritsch can be viewed as spatial explorations of a specific field of discourse. The Internal Boarder (Die innere Grenze/Notranja meja) (2008) and The Monument (Das Denkmal/Spomenik) (2015) were conceived as movements, as surveys of the space and the landscape. By addressing Carinthia’s historiography and culture of remembrance, the works position themselves in a realm infused by conflicting practices of local remembrance, many of which are difficult to follow for outsiders who do not know the background story.[2] They are part of the tradition of the critical examination of the past as can also be found in the work of Jochen Gerz or Milica Tomić. In addition to the motif of movement, both works also share an underlying gesture of showing that can also be interpreted as an esthetic, political, and epistemic act.[3] Through the material, the form, and the esthetics of the works, the viewer is encouraged to participate in a mobile observation – to engage in an intellectual movement.
From West to East
The Internal Boarder (2008) is Six-Petritsch’s first work to examine the impact of Carinthia’s landscape as a resonance space for historical events and the creation of myths. The series of photos shows a movement across the state of Carinthia from west to east. Tied to the photographs of various sections of the landscape is the question: To what extent do depictions of landscape shed light on the views and mentalities of particular collective identities within Carinthia. These have grown out of the historical majority-minority situation of the German-speaking and Slovene-speaking Carinthians.[4]
The historical backdrop is the geopolitical restructuring of Europe after World War I. At the time, the State of SHS (Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes) laid claim to the largely Slovene-speaking territories in southeastern Carinthia. On October 10, 1920, a plebiscite was held to decide which country this region would go to. Nearly 60 percent voted to stay part of Carinthia. The proposed border remained a historical option and never became constitutional law. Large numbers of Carinthian-Slovenes were also among those who chose to remain part of Carinthia. Prior to the plebiscite, however, the State of SHS had occupied southern Carinthia, provoking the “Kärntner Abwehrkampf” (Carinthian defensive struggle) that led to hundreds of deaths. To this day these events play an important role in the local culture of remembrance, which is permeated by the myth of a ‘hostile’ threat coming from the south to usurp territory. Carinthian Slovenes were increasingly depicted as foreigners in their own land. The German-speaking community in Carinthia intentionally sets itself apart from its surroundings in a textbook example of Benedict Anderson’s model of the “imagined community”.[5] In the process, we block out the fact that Carinthian territory has always been multilingual and that most German-Carinthian families also have Slovene roots. The earliest traces of the Slovene language, in fact, were not discovered on Slovene territory, but in Carinthia.[6] To this day, October 10 remains Carinthia’s state holiday.
Six-Petritsch have photographed the course of the proposed border based on historical maps drawn up for the plebiscite. They established a shooting point every two kilometers along the 160-km-long border. The vanishing points of the individual shots also follow the border. The entire series consists of 74 photographs, with 6 shooting points being omitted (those located in Lake Wörth). The work series is presented in various ways. It was originally developed for the large-scale project K08 Emanzipation und Konfrontation (2008), which encompassed numerous museums in Carinthia. All 74 photos were printed as a poster, and museum-goers were free to take a copy from the stack. Two years later as part of the exhibition Heimat/Domovina (2010) at the Carinthian Museum of Modern Art in Klagenfurt the daily newspaper the Kleine Zeitung published the entire series based on the concept of ‘a picture a day’. This was followed in 2015 by a presentation of five images from the series (corresponding to one day of shooting) as part of the group exhibition Disputed Landscape at Camera Austria in Graz. The images were hung as framed prints and displayed for the first time in connection with a historical map from the Carinthian state archive showing the border along which the photographs were taken. Viewers are left with differing – at times insightful, at times confusing – impressions of the landscape and border issue depending on whether the series is shown in its entirety, as an excerpt, or along with a map.
- According to the spatial sociologist Martina Löw the work The Internal Boarder can be described as a “spacing” that leads to “synthesis” on the part of the viewer. “Spacing” is constituted through the “placing of social goods and people in relation to other goods and people or the positioning of primarily symbolic markings” and means “both the aspect of placing and the movement to the next placement.”[7] Through its place of being taken, the series of photographs marks the attempt to show the potential dividing line between those territories that were (largely) German-speaking and those that were (largely) Slovene-speaking. The “processes of perception, imagination, and memory” must be actively brought about by the viewer. They run parallel to the constitution of space and are referred to by Löw as the “operation of synthesis”. It is only through the interaction between the operations of spacing and synthesis that an “individual” aesthetic space can be created.[8] But where is the actual connection between the intended border on the map 100 years ago and the recently taken photographs of the landscape? In the photographic object there is no hint of the alleged discord of a divided landscape to be found in the harmony of the image space. There is no doubt about the historical authenticity of the setup, and yet there isn’t the slightest trace of a border. When the visual material produces ambiguous answers to one’s questions, the viewers must inevitably rely on themselves:
“The border that runs through the middle of the state of Carinthia and which one searches for in the images, knowing that it exists, becomes an invisible trail of remembrance, is perceived as an inner border that exists in one’s head and whose meaning lies in one’s own knowledge and consciousness.”[9]
Through the title of the work, the existence of the border is shifted from the landscape space into the world of the imagination of the viewer.
From South to North and Back
In their second Carinthian project, The Monument (2015), Six-Petritsch stage an intervention into the historical reference system of the complex culture of memorials. They move a monument; namely, one that commemorates the resistance movement of the Carinthian Slovenes during the Nazi regime. The sculpture was erected at the municipal cemetery in Völkermarkt in 1947 by the Allied forces and various Slovene organizations. Six years later it was blown up by unknown aggressors. It wasn’t until 1983 – 30 years after the destruction – that the monument was reconstructed. It was then erected at a new site, at Peršmanhof, a former outpost of the Carinthian partisans near the Austrian border to Slovenia.[10] To the moving history of this monument a spatial movement was added by Six-Petritsch, who drove across Carinthia and back with the monument in tow. The round trip as well as the temporarily empty pedestal were videotaped and the footage was presented for the first time as a video installation at an exhibition at the Kunstraum Lakeside in Klagenfurt in March 2015.
The exhibition space was separated into two areas by a curtain. On one side there was a screen showing the movement of the monument. The video reveals only a small part of the sculpture. At the bottom right we see bronze heads jutting into the frame. From its position on the flatbed of a truck and filmed by a camera mounted on the roof of the truck’s cab, the monument gives a strange impression: While the vehicle remains off screen, the statue glides through the winter landscape almost as if on a sled. The fragmented side view of the sculpture undermines the pathos of its social realist style. Most of the frame shows the landscape along the way. The trajectory of the movement connects the current site of the partisan monument with the place where it was originally erected in 1947. The route takes us northward through southern Carinthia: from Peršmanhof and its remote site high up in the Karawanken range and close to the Slovene border, across the Drava river to the town of Völkermarkt, where, without stopping, we circle once around St. Ruprecht’s cemetery and head back the way we came.
On the other side of the curtain is the other half of the video installation. In the darkened space, visitors can watch a film projection of the temporarily empty pedestal where the group of sculptures normally stands. Because of the empty space, the view here, too, is dominated by the slopes of a coniferous forest.
The video installation can be interpreted as a combination of several spacing processes: the positioning of the project in the exhibition space, the representation of the site of the monument (marked by its pedestal), and the circulation of the sculpture on Carinthian ground. Recording production conditions helped determine the aesthetics of the video installation: Both videos are the result of a continuous shot whose length corresponds to the duration of the journey. They are unedited and shown synchronously in a loop. In this way, the movement of the monument can be experienced as an ongoing, potentially endless process, while the pedestal, which is left behind for the time being, has a confusing and contemplative effect.
The landscape is linked with the exhibition space via the deconstructed views in the video installation. The way each is presented – on a monitor along with headphones through which the viewer can also hear the sound recorded on the road and on the screen of the darkened projection space – elicits an individualized perspective. The subjectively isolated reflection of what is seen ¬– to some extent a mental movement that flows into the spatial movement¬ – is capable of triggering processes of recollection, especially in viewers from Carinthia. The social context of the public exhibition gives rise, at the same time, to a forum for mutual exchange. This process referred to by Löw as an operation of synthesis has the potential to examine one’s often hushed relationship to memories and traumas handed down in the family and to the official culture of remembrance of the state as a result of its history (of resistance).
Points of Intersection
The lines of movement of both works intersect in southern Carinthia. By referencing two historical events that continue to affect the present, they produce friction in the field of local history and memory construction. In the process, however, they do not offer a coherent narrative, no ‘this is how it was’. The main motif of the unpretentiously filmed landscape characterizes the esthetics of the works. It makes reference, on the one hand, to the “traces of the political”[11] inscribed in it; on the other hand, the seemingly innocuous views of the landscape make unclear the social conflicts that started then and continue to this day. After all, Carinthian mentality traditionally regards nature as “a space where you can be without being forced to think about tough historical issues.”[12] It serves as a motif of distraction from political ballast. Thus, the immanent historical references of the works oscillate with the “distraction effects” of the landscape motif. Recollection and repression are combined in a vague but sure way. The search for the invisible Internal Boarder and the dislocation of The Monument scratch through the fragile surface of Carinthian identity constructs. Both works do not merely send political messages, but also confront the viewer “with his/her own social and cultural background assumptions” and in this way encourage one’s own personal spaces for reflection.[13] According to Bernd Liepold-Mosser this is particularly important in the Carinthian context because this area is characterized by an “uncertainty of identity,” a “garbled public discourse”, and a weakly developed “civil society.”[14] It depends on the viewer’s esthetic experience and whether he/she recognizes the symbolism of the structures of the conflicting Carinthian historical discourse, discovers a motive for his/her subjective political opinion, or perhaps perceives only the landscape without its traces of the political. The Carinthian works by Six-Petritsch can be described in the words of Jutta Held as “emotionlessly staged actions” which intervene “in political constellations based on their esthetic constitutions.”[15] According to Rancières, the depicted movements can be seen as instances of reordering space in which even absences are designed to appeal to and be experienced by the senses – and are thus political.[16]
- Text: Erec Gellautz
[1] Helge Schalk “Diskurs: Zwischen Allerweltswort und philosophischem Begriff”, in: Archiv für Begriffsgeschichte 40 (1997/1998), p. 56–104, here p. 103. cf. Katrin Miglar, “Diskurs(ivität)” in: Glossar der Gegenwart, 06-02-2014, http://www.kunsthallewien.at/#/blog/2014/06/diskursivitat (last viewed: 10-02-2019).
[2] Cf. in particular Lisa Rettl, PartisanInnendenkmäler: Antifaschistische Erinnerungskultur in Kärnten (= Der Nationalsozialismus und seine Folgen, vol. 3), Innsbruck/Vienna/Bolzano 2006, p. 19–43.
[3] Cf. Robert Schmidt/Wiebke-Marie Stock/Jörg Volbers (ed.), Zeigen. Dimensionen einer Grundtätigkeit. Weilerswist 2011.
[4] Cf. local language policy regulations and the dispute over city limit signs, in particular Brigitte Entner, “Ungeliebte, unsichtbare Minderheit. Zur Geschichte der Kärntner Slowenen bis in die Gegenwart”, in: Psychologie und Gesellschaftskritik, 39/4 (2015), p. 7–31.
[5] See Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London/New York 1983.
[6] Cf. Heinz-Dieter Pohl, “Zur Diskussion um die Kärntner ‘Landessprache(n)’”, in: Karl Anderwald/Peter Filzmaier/Karl Hren (ed.), Kärntner Jahrbuch für Politik 2017, Hermagoras/Mohorjeva 2017, p. 93–115, here p. 93 f.
[7] Martina Löw, Raumsoziologie, Frankfurt am Main 2001, p. 158 f. Löw also explicitly includes the virtual placing in art, architecture, or computer simulations.
[8] Cf. Juliane Rebentisch, Ästhetik der Installation, Frankfurt am Main 2003, p. 262.
[9] Magdalena Felice, in: Christine Wetzlinger-Grundnig (ed.), Das andere Land. Kärnten|Koroška in Wort und Bild, exhibition catalogue. Carinthian Museum of Modern Art, Klagenfurt, Klagenfurt 2018, p. 90.
[10] Peršmanhof was the site of the massacre committed by National Socialist units against peasant families in April 1945. Today it is a memorial site and a museum commemorating anti-fascist resistance in Carinthia. Cf. Lisa Rettl/Gudrun Blohberger (ed.), Peršman, Göttingen 2014; cf. Rettl 2006 (see note 2), p. 52–59.
[11] Rainer Fuchs (ed.), Natural Histories: Traces of the Political, exhibition catalogue mumok, Vienna, Cologne/Vienna, 2017.
[12] Bernd Liepold-Mosser, “Dås Landle”, in: Wetzlinger-Grundnig 2018 (see note 9), p. 24–25, here p. 24.
[13] Rebentisch 2003 (see note 8), p. 284.
[14] Bernd Liepold-Mosser, “Das andere Land”, in: Wetzlinger-Grundnig 2018 (see note 9), p. 8–10, here p. 9.
[15] Jutta Held, “Einführung: Politische Kunst – Politik der Kunst”, in: Ursula Frohne/Jutta Held (ed.), Kunst und Politik. Jahrbuch der Guernica-Gesellschaft, vol. 9, focus: political art today, Göttingen 2008, p. 9–13, here p. 12.
[16] Cf. Jacques Rancière, Das Unvernehmen. Politik und Philosophie, Frankfurt am Main 2002, p. 41.
Reorganizacija prostora: estetske in politične razsežnosti koroških del Nicole Six in Paula Petritscha
Politična dejavnost je tista dejavnost, ki neko telo odstrani s kraja, ki mu je bil dodeljen, ali ki spremeni krajev namen; povzroči, da je videno tisto, kar ni imelo kraja, da bi lahko bilo videno.
Jacques Rancière, Das Unvernehmen. Politik und Philosophie, Frankfurt na Majni 2002, str. 41.
V skladu z osnovno mislijo tega zbornika je izraz 'gibanje' v tem prispevku opredeljen v zanj značilni večpomenskosti. Širina njegovega pomena združuje estetske, politične in tudi prostorske dimenzije. Pojavom gibanja lahko pripišemo celo epistemski potencial: ni naključje, da izraz 'diskurz' (francosko: discours) izvira iz latinskega izraza discurrere, ki označuje tekanje sem ter tja. Nanaša se na gibanje govora sem ter tja oz. na proces 'razmišljanja kot gibanja misli, kot tekanja razuma sem ter tja'.[1] Navdahnjeni s tem pomenskim obzorjem, lahko projekta, ki sta ju na avstrijskem Koroškem ustvarila avstrijski umetniški duo Nicole Six in Paul Petritsch, razumemo kot prostorsko razgrinjanje specifičnega diskurzivnega polja. Projekta Die innere Grenze/Notranja meja (2008) in Das Denkmal/Spomenik (2015) sta zasnovana kot gibanje, kot merjenje prostora in pokrajine. S tem, ko stvaritvi tematizirata historiografijo in kulturo spominjanja Koroške, se situirata na področje lokalnih praks spominjanja, ki so polne konfliktov, njihova ozadja pa so zunanjim opazovalcem včasih težko razumljiva.[2] Sta del tradicije kritičnega obravnavanja zgodovine, podobno kot to zasledimo tudi v ustvarjanju Jochena Gerza ali Milice Tomić. Poleg motiva gibanja je pri obeh stvaritvah temeljna tudi gesta kazanja, kar lahko prav tako razumemo kot estetsko, politično in epistemsko dejanje.[3] Stvaritvi recipientke in recipiente prek materiala, oblike in estetike spodbujata k mobilnemu premisleku – k izvršitvi intelektualnega premika.
Od zahoda proti vzhodu
Die innere Grenze/Notranja meja (2008) je prvo umetniško delo dua Six-Petritsch, ki obravnava, kako koroška pokrajina učinkuje kot resonančni prostor za zgodovinske dogodke in oblikovanje mitov. Serija fotografij prikazuje gibanje od zahoda proti vzhodu po deželi. V povezavi s fotografijami odsekov terena se postavlja vprašanje, v kolikšni meri lahko prikazi pokrajine pojasnijo predstavne svetove specifičnih koroških identitet. Te se namreč napajajo iz zgodovinske večinske-manjšinske situacije nemško govorečih oz. slovensko govorečih Korošic in Korošcev.[4]
Zgodovinsko ozadje je geopolitična reorganizacija Evrope po prvi svetovni vojni. Država SHS (Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev) je takrat zahtevala večinsko slovensko govoreča območja na jugovzhodu Koroške. 10. oktobra 1920 je potekal plebiscit o tem, kateri državi bo pripadla ta regija. Skoraj 60 odstotkov volivk in volivcev je glasovalo za to, da ostanejo pod Koroško. Meja, o kateri se je glasovalo, je ostala zgodovinska možnost, nikoli pa ni bila državnopravno začrtana. Tudi koroške Slovenke in Slovenci so se v veliki meri odločili za to, da ostanejo pod Koroško. Pred plebiscitom pa je država SHS zasedla južno Koroško in posledično je prišlo do 'koroškega obrambnega boja', ki je terjal na stotine smrtnih žrtev. Vse do danes imajo ti dogodki pomembno vlogo v lokalni spominski kulturi, ki jo zaznamuje mit o nevarnosti 'sovražne' prisvojitve zemlje z juga. Koroške Slovenke in Slovenci so bili vedno bolj stilizirani kot tujci v lastni deželi. V navezavi na Benedikta Andersona lahko na Koroškem eksemplarično opazujemo, kako se je 'namišljena skupnost', tj. nemško govoreča skupnost, omejila navzven, da bi sama sebe doživljala kot namišljeno enoto.[5] Pri čemer se vse do današnjih dni poskuša potlačiti, da je bilo območje Koroške od nekdaj večjezično in da ima večina nemško govorečih koroških družin tudi slovenske korenine. Najstarejši dokazi o obstoju slovenskega jezika ne izvirajo z ozemlja slovenske države, temveč s Koroške.[6] 10. oktober je na Koroškem vse do danes deželni praznik.
Nicole Six in Paul Petritsch sta na podlagi zgodovinskih zemljevidov plebiscita fotografirala potek meje, o katerem se je takrat preudarjalo. Na 160 kilometrov dolgi mejni črti sta na vsakih dveh kilometrih določila točko za fotografiranje. Tudi bežišče posameznih fotografij sledi poteku meje. Celotna serija obsega 74 fotografij (6 lokacij za fotografiranje na Vrbskem jezeru je bilo izpuščenih). Zbirka fotografij je bila predstavljena na različne načine. Prvotno je bila razvita za obširen projekt K08 Emancipacija in konfrontacija (2008), pri katerem so sodelovali številni koroški muzeji – produciran je bil plakat z vsemi 74 fotografijami. Obiskovalke in obiskovalci so si s kupa lahko vzeli svoj izvod plakata. Dve leti pozneje je bila serija po načelu 'ena fotografija na dan' natisnjena v publikaciji Kleine Zeitung v okviru razstave Heimat/Domovina (2010) v Muzeju sodobne umetnosti avstrijske Koroške (MMKK) v Celovcu. Leta 2015 je sledila skupinska razstava Disputed Landscape pri društvu Camera Austria v Gradcu; razstavljenih je bilo pet fotografij iz serije (kar ustreza enemu dnevu fotografiranja), ki so bile natisnjene, uokvirjene in obešene. Tukaj je fotografije prvič dopolnil tudi zgodovinski zemljevid s potekom meje. Zemljevid izvira iz Koroškega deželnega arhiva in je bil razstavljen v vitrini poleg fotografij. Odvisno od tega, ali je serija fotografij predstavljena v celoti, deloma ali skupaj z zemljevidom, nastajajo različni učinki v zvezi s pokrajino in mejno tematiko, ki lahko ali spodbudijo spoznanja ali pa so nerazložljivi.
- V navezavi na sociologinjo prostora Martine Löw lahko projekt Die innere Grenze/Notranja meja opišemo kot t.i. spacing dejanje, ki gledalke in gledalce spodbudi k 'sintetiziranju'. Spacing se nanaša na relacionalno »umestitev družbenih dobrin in ljudi oz. pozicioniranje primarno simboličnih oznak« in vključuje »tako trenutek umestitve kot premik do naslednje umestitve«.[7] Serija fotografij z lokacijo posnetkov predstavlja poskus prikaza potencialne ločnice med takratnim (večinsko) nemško govorečim in (večinsko) slovensko govorečim območjem. Löwova »procese zaznavanja, predstavljanja in spominjanja«, ki se morajo odviti pri opazovalkah in opazovalcih, ter potekajo vzporedno s spacingom, označuje kot 'sintetiziranje'. Šele na podlagi součinkovanja spacinga in sintetiziranja lahko nastane 'poseben' estetski prostor.[8] Toda kakšna je dejanska povezava med začrtano mejo na zemljevidu, o kateri se je pred 100 leti preudarjalo, in današnjimi fotografijami pokrajine? Pri fotografskem objektu v enotnosti slikovnega prostora ni mogoče najti dokazov za domnevno dvojnost razdeljene pokrajine. Kljub zgodovinsko utemeljeni zasnovi eksperimenta meja ni na nikakršen način evidentna. Ko se konzultiranje vizualnega gradiva naposled zaključi, se opazovalke in opazovalci neizogibno vrnejo k samim sebi:
»Meja, ki poteka po notranjosti Koroške in jo na fotografijah iščemo v zavedanju, da obstaja, postane nevidna sled spomina, prepoznamo jo kot notranjo mejo, ki obstaja v naši glavi in katere pomen je v našem lastnem védenju in zavesti.«[9]
Prek naslova stvaritve je obstoj meje premaknjen iz prostora pokrajine v predstavni svet obiskovalk in obiskovalcev.
Od juga proti severu in nazaj
V svojem drugem projektu, ki je nastal na Koroškem, Das Denkmal/Spomenik (2015), Nicole Six in Paul Petritsch posegata v zgodovinski referenčni sistem mnogoplastne kulture spominjanja. Spomenik spravita v gibanje. Gre za spominsko obeležje odporu koroških Slovenk in Slovencev med obdobjem nacionalsocializma. Skulpturo so leta 1947 zavezniki in slovenska združenja postavili na mestnem pokopališču v Velikovcu. Šest let pozneje so jo neznanci razstrelili. Šele leta 1983 – 30 let po uničenju – je bil spomenik rekonstruiran. Novo lokacijo so mu našli na Peršmanu, nekdanjem koroškem partizanskem oporišču na robu avstrijskega državnega ozemlja.[10] Duo Six-Petritsch razgibani zgodovini tega spomenika doda še eno, tj. prostorsko gibanje: prevoz po Koroškem. Ta akcijo, pa tudi začasno prazen podstavek, so obeležile kamere. Iz tako ustvarjenega slikovnega gradiva izhaja videoinstalacija, ki je bila prvič predstavljena marca 2015 na razstavi v celovškem umetniškem prostoru Lakeside.
Razstavni prostor je bil z zaveso razdeljen na dva dela. V prvi polovici je bilo na zaslonu prikazano gibanje spomenika. Na videu je viden le majhen del skulpture – spodaj desno bronaste glave štrlijo v slikovni prostor. Skulptura je bila postavljena na zadnji del kombija in snemana s kamero, ki je bila nameščena na strehi voznikove kabine, kar privede do prav posebnega dojemanja: medtem ko vozilo ostaja izven kadra, se skorajda zdi, da kip po sanišču drsi po zimski pokrajini. Skulpturo, oblikovano v slogu socialističnega realizma, pri fragmentiranem pogledu s strani zaznamuje patos. Pogled na prevoženo pokrajino zajame večino slike. Trajektorija gibanja trenutno lokacijo partizanskega spomenika poveže s krajem, kjer je bil leta 1947 prvotno postavljen. Pot je peljala vzdolž južne Koroške: od odročnega Peršmana, visoko v Karavankah in le streljaj od slovenske meje, čez Dravo do mesteca Velikovec na severu, od tam pa brez postanka okoli pokopališča v Blačah in nato zopet nazaj.
Drugi del videoinstalacije obiskovalke in obiskovalci najdejo v zatemnjenem delu razstavnega prostora. Tam projekcija prikazuje začasno prazen podstavek od skulptur. Glede na to praznino tudi tukaj slikovni prostor zaznamuje pogled na pobočje iglastega gozda.
Videoinstalacijo lahko razumemo kot kombinacijo več procesov spacinga: umestitev projekta v razstavni prostor, reprezentacija lokacije spomenika (označena je z njegovim podstavkom) in kroženje skulpture po koroškem ozemlju. Produkcijski pogoji posnetkov določajo tudi estetiko videoinstalacije: oba videoposnetka sta rezultat nastavitev kamere – njuna dolžina je enaka trajanju krožne vožnje. Videoposnetka sta brez rezov in montaže, predstavljena sta sinhrono in se vseskozi ponavljata. Gibanje spomenika je tako mogoče doživeti kot kontinuiran, potencialno neskončen proces, medtem ko podstavek, ki ostaja na mestu, deluje v enaki meri dražljivo in kontemplativno.
Prek dekonstruiranih razmerij pogleda v videoinstalaciji je prevožena pokrajina povezana z razstavnim prostorom. Način predstavitve na zaslonu – opremljenem s slušalkami, prek katerih se sliši hrup med vožnjo – in v zatemnjeni projekcijski sobi nas prisili v individualiziran način opazovanja. Subjektivno izolirano razmišljanje o videnem – nekakšno miselno gibanje, ki se povezuje s prostorskim gibanjem – lahko zlasti med koroškimi opazovalkami in opazovalci sproži spominske procese. V družbenem kontekstu javne razstave se hkrati oblikuje forum za skupnostno izmenjavo. Ta postopek, ki ga je Löwova opisala kot sintetiziranje, vsebuje potencial za postavljanje vprašanj glede pogosto v molk zavitega odnosa do tradicionalnih družinskih spominov in travm ter do uradne kulture spominjanja dežele glede njene (odporniške) zgodovine.
- Križišča
- Liniji gibanja obeh stvaritev se križata na južnem Koroškem. S sklicevanjem na dva zgodovinska dogodka, ki zaznamujeta sodobne dogodke, ustvarjata trenja na področju lokalne zgodovine in konstrukcije spomina. Pri tem ne ponujata koherentne pripovedi v smislu »tako je bilo«. Estetiko stvaritev zaznamuje glavni motiv pokrajine, ki je posneta na stvaren način. Po eni strani opozarja na 'sledove političnega',[11] ki so vtisnjeni v stvaritvah, po drugi strani pa na videz neškodljivi pogledi na domače loge zameglijo družbene konflikte, ki segajo vse do današnjih dni. V zgodovini koroške mentalitete je narava namreč tradicionalno »prostor, v katerem je človek lahko bil, ne da bi se ukvarjal s trdovratnimi vprašanji glede zgodovine.«[12] Fungira kot motiv odvračanja pozornosti od političnega balasta. Imanentno zgodovinske reference stvaritev tako oscilirajo z 'učinki razpršitve' motiva pokrajine. Spominjanje in potlačenje sta kombinirana na poantirano nedoločljiv način. Iskanje, kje poteka nevidna innere Grenze/Notranja meja, in premikanje kipa Denkmal/Spomenik se dotikata krhkosti koroških konstrukcij identitete. Obe stvaritvi ne pošiljata »zgolj političnih sporočil«, temveč opazovalke in opazovalce soočita »z njihovimi lastnimi domnevami v zvezi z družbo in kulturo«, s čimer odpirata individualne prostore za refleksijo.[13] Če se navežemo na Bernda Liepold-Mosserja, je to še posebej pomembno za koroški kontekst, saj to regijo zaznamuje 'negotovost identitete', 'izmaličen javni diskurz' in neizrazita 'civilna družba'.[14] Od estetske izkušnje opazovalk in opazovalcev je odvisno, ali v stvaritvah simbolično prepoznajo strukture nasprotujočega si koroškega diskurza o zgodovini, najdejo motiv za subjektivno politično stališče, ali pa vendarle dojemajo le krajino brez njenih sledov političnega. Koroški deli dua Six-Petritsch se z besedami Jutte Held lahko opišeta kot »neemocionalno inscenirani dejanji«, ki »na podlagi svoje estetske konstitucije posegata v politične konstelacije".[15] V navezavi na Rancièreja lahko upodobljena gibanja opredelimo kot reorganizacijo prostora, v katerem lahko tudi nenavzočnosti postanejo čutno oblikovane in empirične – in s tem politične.[16]
[1] Helge Schalk, »Diskurs: Zwischen Allerweltswort und philosophischem Begriff«, v: Archiv für Begriffsgeschichte 40 (1997/1998), str. 56–104; tukaj cit. str. 103. Prim. tudi Katrin Miglar, »Diskurs(ivität)«, v: Glossar der Gegenwart, 02. 06. 2014, http://www.kunsthallewien.at/#/blog/2014/06/diskursivitat (dostop: 02. 10. 2019).
[2] Eksemplarično prim. Lisa Rettl, PartisanInnendenkmäler: Antifaschistische Erinnerungskultur in Kärnten (=Der Nationalsozialismus und seine Folgen, Bd. 3), Innsbruck/Dunaj/Bolzano 2006, str. 19–43.
[3] Prim. Robert Schmidt/Wiebke-Marie Stock/Jörg Volbers (ur.), Zeigen. Dimensionen einer Grundtätigkeit. Weilerswist 2011.
[4] Za lokalno jezikovno politiko in spor glede krajevnih napisov eksemplarično prim. Brigitte Entner, »Ungeliebte, unsichtbare Minderheit. Zur Geschichte der Kärntner Slowenen bis in die Gegenwart«, v: Psychologie und Gesellschaftskritik, 39/4 (2015), str. 7–31.
[5] Gl. Benedict Anderson, Die Erfindung der Nation: Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts, Frankfurt na Majni/New York 2005 [1983].
[6] Prim. Heinz-Dieter Pohl, »Zur Diskussion um die Kärntner 'Landessprache(n)'«, v: Karl Anderwald/Peter Filzmaier/Karl Hren (ur.), Kärntner Jahrbuch für Politik 2017, Hermagoras/Mohorjeva 2017, str. 93–115, tukaj cit. str. 93 in nasl.
[7] Martina Löw, Raumsoziologie, Frankfurt na Majni 2001, str. 158 in nasl. Löwova odločno vključi tudi virtualne umestitve v umetnosti, arhitekturi ali računalniških simulacijah.
[8] Prim. Juliane Rebentisch, Ästhetik der Installation, Frankfurt na Majni 2003, str. 262.
[9] Magdalena Felice, v: Christine Wetzlinger-Grundnig (ur.), Das andere Land. Kärnten | Koroška in Wort und Bild, katalog razstave, Museum Moderner Kunst Kärnten, Celovec, Celovec 2018, str. 90.
[10] Na Peršmanu so aprila leta 1945 nacistične vojaške enote umorile kmečko družino. Danes je tam spominsko mesto in muzej antifašističnega odpora na Koroškem. Prim. Lisa Rettl/Gudrun Blohberger (ur.), Peršman, Göttingen 2014; prim. Rettl 2006 (kot pri opombi 2), str. 52–59.
[11] Rainer Fuchs (ur.), Naturgeschichten. Spuren des Politischen, katalog razstave, mumok, Dunaj, Köln/Dunaj, 2017.
[12] Bernd Liepold-Mosser, »Dås Landle«, v: Wetzlinger-Grundnig 2018 (kot pri opombi 9), str. 24–25, tukaj cit. str. 24.
[13] Rebentisch 2003 (kot pri opombi 8), str. 284.
[14] Bernd Liepold-Mosser, »Das andere Land«, v: Wetzlinger-Grundnig 2018 (kot pri opombi 9), str. 8–10, tukaj cit. str. 9.
[15] Jutta Held, »Einführung: Politische Kunst – Politik der Kunst«, v: Ursula Frohne/ Jutta Held (ur.), Kunst und Politik. Jahrbuch der Guernica-Gesellschaft, Bd. 9, Schwerpunkt: Politische Kunst heute, Göttingen 2008, str. 9–13, tukaj cit. str. 12.
[16] Prim. Jacques Rancière, Das Unvernehmen. Politik und Philosophie, Frankfurt na Majni 2002, S. 41.
Den Raum neu ordnen. Ästhetische und politische Dimensionen der Kärntner Werke von Nicole Six und Paul Petritsch
Die politische Tätigkeit ist jene, die einen Körper von dem Ort entfernt, der ihm zugeordnet war oder die die Bestimmung eines Ortes ändert; sie lässt sehen, was keinen Ort hatte gesehen zu werden.
Jacques Rancière, Das Unvernehmen. Politik und Philosophie, Frankfurt am Main 2002, S. 41.
Dem Grundgedanken dieses Bandes folgend wird der Begriff „Bewegung“ in diesem Beitrag in seiner charakteristischen Mehrdeutigkeit gefasst. Seine Bedeutungsbreite verbindet ästhetische politische und auch räumliche Dimensionen. Man kann so weit gehen, Bewegungsphänomenen ein epistemisches Potential beizumessen: Nicht von ungefähr stammt der Begriff „Diskurs“ (frz. discours) vom Lateinischen discurrere, was hin- und herlaufen bedeutet. Er bezieht sich auf die Hin- und Her-Bewegung einer Rede bzw. den Vorgang „des Denkens als Gedankenbewegung, als Hin- und Herlaufen des Verstandes“.[1] Inspiriert von diesem Bedeutungshorizont lassen sich die in Kärnten entstandenen Projekte des österreichischen Künstlerduos Nicole Six und Paul Petritsch als räumliche Entfaltungen eines spezifischen Diskursfeldes verstehen. Die innere Grenze/Notranja meja (2008) und Das Denkmal/Spomenik (2015) sind als Bewegungen, als Vermessungen des Raumes und der Landschaft angelegt. Indem die Werke die Historiografie und die Gedenkkultur Kärntens thematisieren situieren sie sich in einem konfliktreichen Feld lokaler Erinnerungspraktiken, deren Hintergründe für Außenstehende teilweise schwer nachzuvollziehen sind.[2] Sie stehen in der Tradition kritischer Auseinandersetzung mit Geschichte, wie sie auch im Schaffen von Jochen Gerz oder Milica Tomić zu finden sind. Neben dem Motiv der Bewegung liegt beiden Werken eine Geste des Zeigens zugrunde, die ebenfalls als ästhetischer, politischer und epistemischer Akt gelesen werden kann.[3] Über das Material, die Form und die Ästhetik der Werke werden die Rezipient*innen zu einer mobilen Betrachtung angeregt – dazu, eine intellektuelle Bewegung zu vollziehen.
Von Westen nach Osten
Die innere Grenze/Notranja meja (2008) ist die erste künstlerische Arbeit von Six-Petritsch, die Kärntens Landschaft auf ihre Wirkung als Resonanzraum für historische Ereignisse und Mythenbildung befragt. Die Fotoserie veranschaulicht eine Bewegung von Westen nach Osten quer durchs Land. Verbunden mit den Fotografien von Geländeausschnitten ist die Frage, inwieweit Landschaftsdarstellungen Aufschluss über die Vorstellungswelten von spezifischen Kärntner Identitäten geben können. Diese speisen sich aus der historischen Mehrheiten-Minderheiten-Situation von deutschsprachigen und slowenischsprachigen Kärntner*innen.[4]
Geschichtlicher Hintergrund ist die geopolitische Neuordnung Europas nach dem Ersten Weltkrieg. Der SHS-Staat (Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen) erhob damals Anspruch auf die mehrheitlich slowenisch-sprachigen Gebiete im Südosten Kärntens. Am 10. Oktober 1920 wurde eine Volksabstimmung über die staatliche Zugehörigkeit dieser Region abgehalten. Fast 60 Prozent der WählerInnen sprachen sich für einen Verbleib bei Kärnten aus. Die zur Abstimmung gebrachte Grenze blieb eine historische Option, staatsrechtlich wurde sie niemals gezogen. Auch die Kärntner SlowenInnen haben sich zu einem erheblichen Teil für einen Verbleib bei Kärnten entschieden. Vor der Volksabstimmung war es jedoch zu Besetzungen Süd-Kärntens durch den SHS-Staat und in der Folge zum „Kärntner Abwehrkampf“ mit hunderten Toten gekommen. Diese Ereignisse spielen bis heute eine wichtige Rolle in der lokalen Erinnerungskultur, die geprägt ist von der Mythenbildung einer Gefahr ‚feindlicher‘ Landnahme von Süden. Die Kärntner Slowen*innen wurden zunehmend zu Fremden im eigenen Land stilisiert. In Anlehnung an Benedikt Anderson kann man in Kärnten exemplarisch beobachten, wie sich eine „imagined community“ als deutschsprachige Gemeinschaft nach außen abgrenzt um sich als imaginierte Einheit zu erfahren.[5] Dabei wird bis in die Gegenwart verdrängt, dass das Gebiet Kärntens schon immer mehrsprachig war und die meisten deutsch-kärntner Familien auch slowenische Wurzeln haben. Die ältesten Zeugnisse der slowenischen Sprache liegen nicht auf slowenischem Staatsgebiet, sondern in Kärnten.[6] Der 10. Oktober ist bis heute Kärntens Landesfeiertag.
Six-Petritsch haben den damals erwogenen Grenzverlauf auf Basis von historischen Landkarten der Volksabstimmung fotografiert. Auf der 160 km langen Grenzlinie legten sie alle zwei Kilometer einen Aufnahmepunkt fest. Auch der Fluchtpunkt der Einzelaufnahmen folgt dem Grenzverlauf. Die gesamte Serie umfasst 74 Fotografien (6 Aufnahmestellen, die im Wörthersee liegen, wurden ausgelassen). Die Werkgruppe wird auf unterschiedliche Weise präsentiert. Sie wurde ursprünglich für das viele Kärntner Museen umspannende Großprojekt K08 Emanzipation und Konfrontation (2008) entwickelt und in Form eines Posters mit allen 74 Aufnahmen produziert. Besucher*innen durften sich ein Exemplar von einem Stapel mitnehmen. Zwei Jahre später wurde die Serie im Rahmen der Ausstellung Heimat/Domovina (2010) im Museum Moderner Kunst Kärnten in Klagenfurt in der Kleinen Zeitung nach dem Prinzip ‚jeden Tag ein Bild‘ abgedruckt. 2015 folgte die Gruppenausstellung Disputed Landscape in der Camera Austria in Graz mit einer Präsentation von 5 Bildern der Serie (entsprechend einem Aufnahmetag), die als gerahmte Prints gehängt wurden. Hier ergänzte auch erstmals eine historische Karte mit dem Grenzverlauf die Fotografien. Sie stammte aus dem Kärntner Landesarchiv und wurde in einer Vitrine neben den Fotografien gezeigt. Je nach dem ob die Serie komplett, als Ausschnitt oder gemeinsam mit einer Karte präsentiert wird, ergeben sich unterschiedliche Wirkungen von Landschaft und Grenzthematik, die sowohl erkenntnisstiftend als auch rätselhaft sein können.
- Mit der Raumsoziologin Martina Löw lässt sich Die innere Grenze/Notranja meja als „Spacing“-Aktion beschreiben, welche die BetrachterInnen zu einer „Syntheseleistung“ anregt. „Spacing“ bezeichnet das relationale „Platzieren von sozialen Gütern und Menschen bzw. das Positionieren von primär symbolischen Markierungen“ und bezieht „sowohl den Moment der Platzierung als auch die Bewegung zur nächsten Platzierung“ mit ein.[7] Die Fotoserie markiert durch ihren Aufnahmeort den Versuch die potenzielle Scheidelinie zwischen den damals (mehrheitlich) deutsch- und (mehrheitlich) slowenischsprachigen Gebieten zu zeigen. Die parallel zum Spacing ablaufenden „Wahrnehmungs-, Vorstellungs- und Erinnerungsprozesse“ – die von den BetrachterInnen zu leisten sind – charakterisiert Löw als „Syntheseleistung“. Erst aus dem Zusammenwirken von Spacing und Syntheseleistung kann ein „eigener“ ästhetischer Raum entstehen.[8] Doch wo liegt der tatsächliche Zusammenhang zwischen der erwogenen Grenzziehung auf der Landkarte vor 100 Jahren und den Landschaftsaufnahmen von heute? Am fotografischen Objekt findet sich in der Einheit des Bildraums kein Hinweis auf die vorgebliche Zweiheit einer geteilten Landschaft. Trotz des historisch fundierten Versuchsaufbaus gibt es keinerlei Evidenz einer Grenze. Gerät die Befragung des visuellen Materials schließlich ins Stocken werden die Betrachter*innen unweigerlich auf sich selbst zurückgeworfen:
„Die Grenze, die das Innere des Landes Kärnten durchzieht und die man in den Bildern im Wissen um ihre Existenz sucht, wird zur unsichtbaren Erinnerungsspur, wird als innere Grenze gewahr, die im Kopf existiert und deren Bedeutung im eigenen Wissen und Bewusstsein liegt.“[9]
Durch den Titel wird die Existenz der Grenze aus dem Landschaftsraum verschoben in die eigene Vorstellungswelt der Betrachter*innen.
Von Süden nach Norden und zurück
In ihrem zweiten in Kärnten entstandenen Projekt, Das Denkmal/Spomenik (2015), greifen Six-Petritsch in das historische Referenzsystem der vielschichtigen Memorialkultur ein. Sie versetzen ein Denkmal in Bewegung. Es handelt sich um ein Mahnmal für den Widerstand der Kärntner SlowenInnen in der Zeit des Nationalsozialismus. Die Skulptur wurde 1947 von den Alliierten und slowenischen Verbänden auf dem städtischen Friedhof in Völkermarkt errichtet. Sechs Jahre später haben Unbekannte sie gesprengt. Erst 1983 – 30 Jahre nach der Zerstörung – wurde das Denkmal rekonstruiert. Es fand einen neuen Aufstellungsort auf dem Peršmanhof, einem ehemaligen Stützpunkt der Kärntner PartisanInnen am Rande des österreichischen Staatsgebiets.[10] Der bewegten Geschichte dieses Denkmals fügen Six-Petritsch eine weitere, räumliche Bewegung hinzu: eine Rundfahrt durch Kärnten. Die Aktion, aber auch der temporär leere Sockel werden von Kameras aufgezeichnet. Aus dem so generierten Bildmaterial geht eine Videoinstallation hervor, die im März 2015 erstmals in einer Ausstellung im Klagenfurter Kunstraum Lakeside präsentiert wurde.
Der Ausstellungsraum wurde durch einen Vorhang in zwei Bereiche unterteilt. In der ersten Hälfte hing ein Screen, auf dem die Verschiebung des Mahnmals zu sehen war. Das Video zeigt nur einen kleinen Ausschnitt der Skulpturengruppe. Rechts unten ragen bronzene Köpfe in den Bildraum hinein. Platziert auf der Ladefläche eines Transporters und gefilmt mit einer auf dem Dach der Fahrerkabine installierten Kamera, ergibt sich eine eigentümliche Wahrnehmung: Während das Fahrzeug im Offspace verbleibt, wirkt das Standbild geradezu als würde es auf Kufen durch eine winterliche Landschaft gleiten. In der fragmentierten Seitenansicht wird das Pathos der im Stil des sozialistischen Realismus gestalteten Skulptur unterlaufen. Der größte Teil des Bildes bleibt dem Ausblick auf die durchquerte Landschaft vorbehalten. Die Trajektorie der Bewegung verbindet den heutigen Standort des Partisan*innendenkmals mit jenem Ort, an dem es 1947 ursprünglich errichtet wurde. Der Weg führt einmal längs durch Südkärnten: vom entlegenen Peršmanhof, hoch oben in den Karawanken und nur einen Steinwurf von der slowenischen Grenze entfernt, über den Fluss Drau in das nördlich gelegene Städtchen Völkermarkt und dort, ohne anzuhalten, um den Friedhof von St. Ruprecht herum und wieder zurück.
Auf den zweiten Teil der Videoinstallation stoßen die Besucher*innen im abgedunkelten Bereich des Ausstellungsraums. Dort führt eine Projektion den temporär leeren Sockel der Skulpturengruppe vor Augen. Angesichts der Leerstelle bestimmt auch hier der Ausblick auf die Hänge eines Nadelwaldes den Bildraum.
Die Videoinstallation lässt sich als Verknüpfung mehrerer Spacing-Vorgänge auffassen: die Situierung des Projekts im Ausstellungsraum, die Repräsentation des Denkmalstandorts (markiert durch seinen Sockel) und die Zirkulation der Skulptur auf Kärntner Terrain. Die Produktionsbedingungen der Aufnahmen definieren auch die Ästhetik der Videoinstallation: Beide Videos resultieren aus Kamera-Einstellungen, deren Länge der Dauer der Rundfahrt entsprechen. Sie werden ohne Schnitt und Montage synchron im Loop präsentiert. So wird die Bewegung des Denkmals als kontinuierlicher, potenziell unendlicher Vorgang erfahrbar, während das zurückgelassene Postament gleichermaßen irritierend und kontemplativ wirkt.
Über die dekonstruierten Blickverhältnisse in der Videoinstallation wird der durchquerte Landschaftsraum mit dem Ausstellungsraum verschaltet. Die Präsentationsweise auf einem Screen – ausgestattet mit Kopfhörer, über den Fahrgeräusche zu hören sind – und im abgedunkelten Projektionsraum forciert eine individualisierte Betrachtungsweise. Die subjektiv isolierte Reflektion über das Gesehene – gewissermaßen eine geistige Bewegung, die an die räumliche anschließt – vermag insbesondere bei Kärntner Betrachter*innen Erinnerungsvorgänge auszulösen. Im sozialen Kontext der öffentlichen Ausstellung entsteht zugleich ein Forum für den gemeinschaftlichen Austausch. Dieser von Löw als Syntheseleistung bezeichnete Vorgang birgt das Potential, das oftmals in Schweigen gehüllte Verhältnis zu den familiär tradierten Erinnerungen, Traumata und zur offiziellen Gedenkkultur des Landes hinsichtlich seiner (Widerstands-)Geschichte zu befragen.
Kreuzungspunkte
Die Bewegungslinien beider Werke kreuzen sich in Südkärnten. Durch die Bezugnahme auf zwei historische und die Gegenwart prägende Ereignisse erzeugen sie Reibung im Feld der Lokalgeschichte und der Konstruktion von Erinnerung. Dabei liefern sie keine kohärente Erzählung, kein ‚es ist so gewesen‘. Das Hauptmotiv der Landschaft, die nüchtern aufgezeichnet wird, prägt die Ästhetik der Arbeiten. Sie verweist einerseits auf die in sie eingeschriebenen „Spuren des Politischen“[11], andererseits werden in den harmlos wirkenden Gefildeansichten die bis in die Gegenwart ausstrahlenden gesellschaftlichen Konflikte verunklärt. Denn die Natur ist in der Kärntner Mentalitätsgeschichte traditionell „ein Raum, in dem man sein konnte, ohne sich mit den hartnäckigen Fragen der Geschichte auseinandersetzen zu müssen.“[12] Sie fungiert als Motiv der Ablenkung von politischem Ballast. Die immanent historischen Bezüge der Arbeiten oszillieren also mit den „Zerstreuungseffekten“ des Motivs der Landschaft. Erinnern und Verdrängen werden auf pointiert-unentscheidbare Weise miteinander kombiniert. Die Suche nach der unsichtbaren inneren Grenze/Notranja meja und die Dislozierung des Denkmal/Spomenik kratzen an der Brüchigkeit der Kärntner Identitätskonstruktionen. Beide Werke senden „nicht einfach politische Botschaften“, sondern konfrontieren die BetrachterInnen „mit den eignen sozialen und kulturellen Hintergrundannahmen“ und eröffnen so individuelle Reflektions(spiel)räume.[13] Folgt man Bernd Liepold-Mosser, ist dies gerade für den Kärntner Kontext wichtig, da dieser Landstrich geprägt sei von einer „Ungewissheit der Identität“, einem „verstümmelte[n] öffentliche[n] Diskurs“ und einer schwach ausgeprägten „Bürgergesellschaft“.[14] Es bleibt der ästhetischen Erfahrung der BetrachterInnen überlassen, ob sie in den Arbeiten sinnbildhaft die Strukturen des konfligierenden Kärntner Geschichtsdiskurses (wieder-)erkennen, Movens zur subjektiven politischen Stellungnahme finden oder doch nur die Landschaft ohne ihre Spuren des Politischen wahrnehmen. Die Kärntner Werke von Six-Petritsch lassen sich mit Jutta Held als „emotionslos inszenierte Handlung[en]“ beschreiben, „die in politische Konstellationen aufgrund ihrer ästhetischen Konstitution“ eingreifen.[15] Im Sinne Rancières können die dargestellten Bewegungen als Neuordnungen des Raumes bestimmt werden, in denen auch Abwesenheiten sinnlich gestaltet und erfahrbar – und damit politisch – werden.[16]
- Der Text [Auszug] stammt aus dem Artikel: Erec Gellautz, „Den Raum neu ordnen – Ästhetische und politische Dimensionen der Kärntner Werke von Nicole Six und Paul Petritsch“ in: Lilian Haberer/Karina Nimmerfall (Hg.), Movement | Mouvement. Handlungsfelder des Ästhetischen und Politischen. Festschrift für Ursula Frohne, Edition Metzel, München 2020
[1] Helge Schalk „Diskurs: Zwischen Allerweltswort und philosophischem Begriff“, in: Archiv für Begriffsgeschichte 40 (1997/ 1998), S. 56–104, hier S. 103. Vgl. auch Katrin Miglar, „Diskurs(ivität)“ in: Glossar der Gegenwart, 02.06.2014, http://www.kunsthallewien.at/#/blog/2014/06/diskursivitat (letzte Sichtung: 02.10.2019).
[2] Vgl. exemplarisch Lisa Rettl, PartisanInnendenkmäler: Antifaschistische Erinnerungskultur in Kärnten (= Der Nationalsozialismus und seine Folgen, Bd. 3), Innsbruck/ Wien/ Bozen 2006, S. 19–43.
[3] Vgl. Robert Schmidt/ Wiebke-Marie Stock/ Jörg Volbers (Hg.), Zeigen. Dimensionen einer Grundtätigkeit. Weilerswist 2011.
[4] Vgl. zur lokalen Sprachpolitik und zum Ortstafelstreit exemplarisch Brigitte Entner, „Ungeliebte, unsichtbare Minderheit. Zur Geschichte der Kärntner Slowenen bis in die Gegenwart“, in: Psychologie und Gesellschaftskritik, 39/4 (2015), S. 7–31.
[5] Siehe Benedict Anderson, Die Erfindung der Nation: Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts, Frankfurt am Main/ New York 2005 [1983].
[6] Vgl. Heinz-Dieter Pohl, „Zur Diskussion um die Kärntner ‚Landessprache(n)‘“, in: Karl Anderwald/ Peter Filzmaier/ Karl Hren (Hg.), Kärntner Jahrbuch für Politik 2017, Hermagoras/ Mohorjeva 2017, S. 93–115, hier S. 93 f.
[7] Martina Löw, Raumsoziologie, Frankfurt am Main 2001, S. 158 f. Auch virtuelle Platzierungen in Kunst, Architektur oder Computersimulationen schließt Löw dezidiert ein.
[8] Vgl. Juliane Rebentisch, Ästhetik der Installation, Frankfurt am Main 2003, S. 262.
[9] Magdalena Felice, in: Christine Wetzlinger-Grundnig (Hg.), Das andere Land. Kärnten | Koroška in Wort und Bild, Ausst.-Kat. Museum Moderner Kunst Kärnten, Klagenfurt, Klagenfurt 2018, S. 90.
[10] Der Peršmanhof war im April 1945 Schauplatz eines von NS-Einheiten verübten Massakers an den Bauernfamilien. Heute ist er eine Gedenkstätte und ein Museum für den antifaschistischen Widerstand in Kärnten. Vgl. Lisa Rettl/ Gudrun Blohberger (Hg.), Peršman, Göttingen 2014; vgl. Rettl 2006 (wie Anm. 2), S. 52–59.
[11] Rainer Fuchs (Hg.), Naturgeschichten. Spuren des Politischen, Ausst.-Kat. mumok, Wien, Köln/ Wien, 2017.
[12] Bernd Liepold-Mosser, „Dås Landle“, in: Wetzlinger-Grundnig 2018 (wie Anm. 9), S. 24–25, hier S. 24.
[13] Rebentisch 2003 (wie Anm. 8), S. 284.
[14] Bernd Liepold-Mosser, „Das andere Land“, in: Wetzlinger-Grundnig 2018 (wie Anm. 9), S. 8–10, hier S. 9.
[15] Jutta Held, „Einführung: Politische Kunst – Politik der Kunst“, in: Ursula Frohne/ Jutta Held (Hg.), Kunst und Politik. Jahrbuch der Guernica-Gesellschaft, Bd. 9, Schwerpunkt: Politische Kunst heute, Göttingen 2008, S. 9–13, hier S. 12.
[16] Vgl. Jacques Rancière, Das Unvernehmen. Politik und Philosophie, Frankfurt am Main 2002, S. 41.






The film Ohne Titel (Alberner Hafen), 2017 is part of a series made with a video camera, the recordings of which were triggered by a heat-motion sensor. Each shot takes 60 seconds; then the camera returns to standby mode until it is triggered once again. The clips thus created are presented as seamless sequence. They show a piece of nature. For long stretches it’s not clear what may have triggered the camera. The camera’s static position, the unabridged juxtaposition of all recorded sequences in full length, and the vacancy of significant events lend the work a minimalistic aesthetics. But what can viewers actually realise with this experimental set-up? A categorisation in interesting and uninteresting recordings, in well-made and poor images leads nowhere. Instead, the dispositive of the view itself is emphasised, without showing the technology that allows it to become visible at all. In this double bind of field observation and epistemology, viewers are directed to epistemological questions: What can we record with today’s media? How can we interpret the data compiled? And what slips our attention, for instance in those stretches when the camera was not activated? In times of an incessant mapping of the world and measuring oneself these are important questions in order to critically reflect on our attitude towards the environment that is largely transmitted via media.
Nicole Six and Paul Petritsch usually don’t endeavour to deliberately make their artworks appear interesting. This is not due to indifference towards their environment but rather to their interest in its latent principles and correlations. While the globe has been measured, mapped and documented in many different ways, their works elicit new discoveries and perspectives of the world. With this, they frequently suggest a fertile doubt about the possibilities and limits of the artistic media they use, photography and video. The works’ settings often resemble experimental set-ups that not only address the observed event but also present the method of its visual recording.
Text: Erec Gellautz
Translation: Jeanette Pacher
Der Film Ohne Titel (Alberner Hafen), 2017 ist Teil einer Serie, die mit einer Videokamera hergestellt wurde. Die Aufnahmen wurden durch einen Sensor ausgelöst, der auf Bewegung oder Wärme reagiert. Jeder Shot dauert 60 Sekunden – danach verharrt die Kamera im Standby, bis sie wieder ausgelöst wird. Die so entstandenen Clips werden aneinandergereiht präsentiert. Sie zeigen ein Stück Natur. Über weite Strecken ist nicht klar, welches Ereignis die Kamera ausgelöst haben könnte. Durch die statische Kameraposition, die ungekürzte Aneinanderreihung aller aufgezeichneten Sequenzen in voller Länge und die Vakanz von bedeutsamen Ereignissen entwickelt die Arbeit eine minimalistische Ästhetik. Doch was können die Zuschauerinnen in der Versuchsanordnung eigentlich erkennen? Eine Kategorisierung in interessante oder uninteressante Aufnahmen, in gelungene oder schlechte Bilder führt nicht weiter. Stattdessen tritt das Blick-Dispositv selbst in den Vordergrund, ganz ohne ein Sichtbarwerden seiner Technologie. In diesem Double Bind von Naturbeobachtung und Erkenntnistheorie werden die Betrachterinnen auf erkenntnistheoretische Fragen zurückgeworfen: Was können wir mit den heutigen Medien aufzeichnen? Wie können wir die gesammelten Daten lesen? Und was entgeht uns – beispielsweise in jenen Momenten, in denen die Kamera nicht ausgelöst wurde? In einer Zeit permanenter Welt- und Selbstvermessung sind diese Fragen wichtig, um unseren in weiten Teilen medienvermittelten Zugang zur Umwelt kritisch zu reflektieren.
Nicole Six und Paul Petritsch sind meist nicht darum bemüht ihre künstlerischen Arbeiten absichtsvoll interessant wirken zu lassen. Dahinter steckt keine Gleichgültigkeit ihrer Umwelt gegenüber, sondern ein Interesse an den verborgenen Gesetzmäßigkeiten ihrer Zusammenhänge. Obwohl der Erdball schon vielfach vermessen, aufgezeichnet und dokumentiert wurde, entlocken ihre Werke der Welt neue Entdeckungen und Sichtweisen. Dabei bringen sie oft einen produktiven Zweifel an den Möglichkeiten und Begrenzungen ihrer künstlerischen Medien – Fotografie und Video – ins Spiel. Das Setting ihrer Arbeiten hat oft den Charakter einer Versuchsanordnung, in der nicht nur der beobachtete Vorgang, sondern auch die Art und Weise seiner visuellen Aufzeichnung thematisch werden.
Text: Erec Gellautz